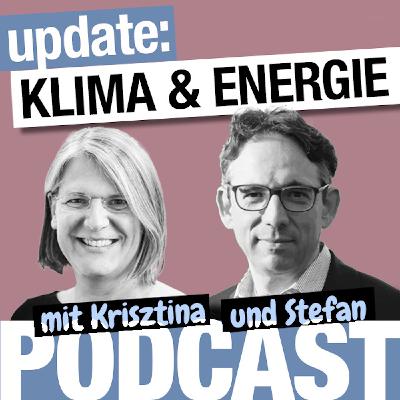Discover Update Klima & Energie
Update Klima & Energie

Update Klima & Energie
Author: Stefan Gsänger
Subscribed: 34Played: 1,087Subscribe
Share
© Gsänger
Description
Krisztina André und Stefan Gsänger, die sich weltweit und vor Ort für den Wechsel hin zu 100% Erneuerbaren Energien einsetzen, im Gespräch mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu den Chancen der dezentralen Bürgerenergiewende. Jeden zweiten Mittwoch auf allen gängigen Plattformen.
87 Episodes
Reverse
Die vielfältigen Vorteile eines Umstiegs auf Erneuerbare Energien liegen auf der Hand: Die Energiewende kann zu niedrigeren Energiepreisen beitragen, die Resilienz und Versorgungssicherheit erhöhen und sogar die Demokratie stärken. Trotz dieser klar belegbaren Fakten wird die öffentliche Debatte jedoch häufig sehr emotional geführt und hat bereits zu einer deutlichen gesellschaftlichen Polarisierung beigetragen.
Gero Rueter ist Redakteur bei der Deutschen Welle, dem deutschen Auslandssender, und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Energiewende und Klimaschutz. In seinen Beiträgen stützt er sich konsequent auf Daten und Fakten, um zentrale Aussagen nachvollziehbar zu belegen. Mit ihm sprechen wir darüber, welche Rolle Medien in der öffentlichen Debatte spielen, wie sich faktenbasierte Berichterstattung zur Darstellung von Meinungsvielfalt verhält und inwieweit Medien selbst von Interessen beeinflusst sind.
Die Wärmeversorgung zählt bislang zu den Bereichen der Energiewende, in denen die Fortschritte besonders begrenzt sind. Neben dem relativ stabilen Beitrag der Bioenergie hat sich in den letzten Jahren jedoch die Wärmepumpe als massentaugliche Lösung etabliert. Ihre technische Leistungsfähigkeit wurde kontinuierlich weiterentwickelt und deutlich verbessert.
Unser Gast Marek Miara beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten als Wissenschaftler mit der Wärmepumpentechnologie. Im Gespräch gehen wir auf die technischen Entwicklungen, Einsatzmöglichkeiten und bestehenden Grenzen von Wärmepumpen ein. Vor allem aber diskutieren wir, warum sich die öffentliche Debatte rund um die Wärmepumpe in den vergangenen Jahren stark polarisiert hat – und wie dieser Polarisierung sachlich und konstruktiv begegnet werden kann.
Die Erneuerbaren Energien boomen weltweit und haben Investitionen in fossile Energieträger längst überholt. Technische Innovationen und massive Kostensenkungen haben ihre Wettbewerbsfähigkeit eindeutig unter Beweis gestellt. Eigentlich scheint ihr weiterer Siegeszug kaum noch aufzuhalten.
Und doch mehren sich zuletzt alarmierende Signale – insbesondere aus den USA. Äußerungen und politische Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump stellen den Ausbau der Erneuerbaren Energien zunehmend infrage, bis hin zu Forderungen nach drastischen Einschränkungen oder sogar Verboten.
In diesem Podcast sprechen wir mit Hans-Josef Fell, ehemaligem Mitglied des Deutschen Bundestages und Präsident der Energy Watch Group, über den aktuellen Stand der globalen Energiewende. Wer treibt sie international voran, wer bremst? Welche Länder haben am meisten zu verlieren – und welche am meisten zu gewinnen? Welche Rolle spielt Deutschland heute, und wie positioniert sich Europa im internationalen Wettbewerb der Erneuerbaren Energien? Wer sind die entscheidenden Akteure auf globaler Ebene – oder liegt der Schlüssel zum Erfolg letztlich auf der lokalen Ebene?
Die Welt steht energiepolitisch am Scheideweg. Während einerseits die Erneuerbaren Energien heute technologisch ausgereift, überall verfügbar und ökonomisch unschlagbar sind, wird vor allem von den USA ausgehend der Druck auf die Energiewende immer stärker. Gleichzeitig hat in vielen Bereichen China nicht nur beim Ausbau der Erneuerbaren Energien die Führung übernommen, sondern das Land ist in vielen Bereichen auch technologisch führend.
Krisztina und Stefan sprechen darüber, wo sich Europa angesichts dieser Polarisierung positionieren sollte. Auf dem Kontinent sind viele maßgebliche Entwicklungen angestoßen worden, allerdings gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch immer wieder Rückschritte, oft von der fossilen Energiewirtschaft erzwungen. Die europäischen Gründungsprinzipien Demokratie, Dezentralität und Partizipation bieten die Grundlage für ein eigenständiges europäisches Modell für die Energiewende. Wie kann Europa auf dieser Basis wieder auf die Erfolgsspur kommen und vielleicht sogar international zum Vorbild werden?
Nach mehreren Jahren mit geringem oder keinem Wachstum herrschte auf der gerade zu Ende gegangenen deutschen Leitmesse für Windenergie Husum Wind eine optimistische Stimmung vor – wenn auch die neueren Verlautbarungen der Bundeswirtschaftsministerin für Irritationen sorgten. Nach dem tiefen Investitionseinbruch im Jahr 2019 zeichnet sich in diesem Jahr endlich eine deutliche Erholung ab, wenn auch noch nicht auf dem früheren Niveau.
Christoph Hüls ist Geschäftsführer des Bürgerenergieverbundes Steinfurt, einem Zusammenschluss von Bürgerenergieprojekten, der gemeinsam etwa 250 Megawatt an Windparks betreibt. Wir sprechen mit ihm darüber, wie es dem Bürgerwindverbund gelungen ist, ein wichtiger regionaler Akteur zu werden. Was können andere Akteure von der Steinfurter Erfolgsgeschichte lernen? Wie war die Stimmung der Windbranche beim jährlichen Branchentreffen und was sollte sich auf Bundes- und Landesebene ändern?
Die Bundesnetzagentur wurde eingerichtet, um unter anderem auf dem Strommarkt faire Marktbedingungen, offenen Wettbewerb und ein hohes Maß an Verbraucherschutz zu gewährleisten. Die Agentur berät auch die Bundesregierung und erstellt Studien und Pläne zur Weiterentwicklung des Stromsektors, zuletzt der Bericht zur Versorgungssicherheit in der Stromversogung. Immer wieder gibt es in diesem Zusammenhang allerdings Kritik an der Einrichtung, dass sich bestimmte Perspektiven stärker in solchen Papieren wiederfinden - vor allem die großer, fossiler Konzerne.
Unser Gast Carsten Pfeiffer leitet die Abteilung für Strategie und Politik beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft bne. Er hat vor allem den jüngsten Plan zur Versorgungssicherheit kritisch analysiert und ist dabei auf schwerwiegende Lücken und Defizite gestoßen - so wurden nicht einmal derzeit bestehende Batterie-Großspeicher in den Szenarien berücksichtigt. Wir sprechen mit ihn über die Schwächen, politische Hintergründe und die Frage, ob die Bundesnetzagentur ihre Aufgaben neutral und im Sinne eines schnellstmöglichen und möglichst kostengünstigen Wechsels zu den Erneuerbaren Energien wahrnimmt.
Da Sonne und Wind als praktisch überall verfügbare, preiswerte und gleichzeitig variable Energiequellen künftig die Hauptlast der Energieversorgung tragen werden, bedarf es komplementärer Technologien wie verschiedene Speicher - ob stationär oder mobil. Insbesondere die Batterietechnik hat in den letzen Jahren enorme Fortschritte gemacht, sowohl bei der technischen Leistungsfähigkeit wie auch hinsichtlich der Kostenentwicklung.
Unser Gast Maximilian Fichtner ist einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Batterietechnik und leitet das Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung (HIU) sowie das Center for Electrochemical Energy Storage Ulm-Karlsruhe. Wir sprechen mit ihm darüber, welche technischen Fortschritte Batterien in den letzten Jahren gemacht haben und welche Verbesserungen noch zu erwarten sind. Welche Rolle können Batterien heute schon bei der Energieversorgung einnehmen und was sind die derzeit größten Hemmnisse? Wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern bei Forschung, Fertigung und Nutzung da?
Der Wechsel hin zu den Erneuerbaren Energien findet vor allem auf lokaler, dezentraler Ebene statt und wird in Deutschland von Millionen von Menschen aktiv getragen und vorangetrieben - sei es als Betreiber von kleinen Solaranlagen, als Mitglied in einer Energiegenossenschaft, als Landwirte, klein- und mittelständisches Unternehmen etc. Wie auch in anderen Politikfeldern werden solche breiten Interessen in der Politik oft nicht ausreichend wahrgenommen und ihre Anliegen werden bei politischen Entscheidungen oft nur marginal berücksichtig. Große Konzerne verfügen dagegen über finanziell gut ausgestattete Verbände und sind in der Regel auch bis hinein in die Parlamente und in die Ministerien gut vernetzt.
Unser Gast Lorenz Gösta Beutin ist Abgeordneter des Deutschen Bundestages für die Partei Die Linke, leitet seit dem Beginn der Legislaturperiode den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit und beschäftigt sich seit vielen Jahren politisch mit der Energiewende. Wir sprechen mit ihm darüber, ob die Breite der gesellschaftlichen Energiewendebewegung im Bundestag überhaupt quer durch die Parteien wahrgenommen wird.
Gibt es im deutschen Parlament ein Bewusstsein dafür, dass Klimapolitik so gestaltet sein kann und letztlich sein muss, damit sie der Mehrheit der Bevölkerung zugute kommt?.
Bereits vor mehreren Jahren hat die Europäische Union beschlossen, dass die Bürgerinnen und Bürger günstigeren Strom aus Erneuerbaren Energien beziehen können, wenn sie Teil einer Energiegemeinschaft sind. Dieses sogenannte Energy Sharing ermöglicht den Bezug von Strom ohne bzw. mit geringeren Abgaben und Steuern und könnte die Verbraucher*innen in Deutschland um Milliarden entlasten. Anders als zahlreiche andere Länder hat Deutschland diese EU-Vorgabe aber noch nicht in nationales Recht umgesetzt - im schwarzroten Koalitionsvertrag ist es allerdings vorgesehen.
Unser Gast Valentin Neuhauser lebt in Österreich und unterstützt dort mit seinem Unternehmen die Gründung von Energiegemeinschaften, mit deren Hilfe die Menschen günstigen Strom direkt aus Stromerzeugungsanlagen vor Ort beziehen können. Er erläutert uns die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich und erklärt, wie eine Energiegemeinschaft in der Praxis funktioniert. Wir sprechen auch darüber, wie durch Energy Sharing die Energiewende an Fahrt gewinnen kann und die Menschen die Vorteile auch direkt finanziell spüren.
Der erfreuliche Boom der Solarenergie in Deutschland und weltweit führt dazu, dass es immer häufiger zu Situationen kommt, in denen die Menge des produzierten Solarstroms den Bedarf an Strom übertrifft - es kann tatsächlich zu viel Strom geben. Auch angesichts des erwünschten Zubaus bei der Windenergie können ähnliche Einspeisespitzen auftreten. Es stellt sich die Frage, wie der Überschuss-Strom sinnvoll genutzt werden kann. Derzeit scheint die Politik mit dieser Aufgabe in weiten Teilen überfordert zu sein.
Ralf Bischof ist Experte für Erneuerbare Energien und arbeitet seit 30 Jahren für die Energiewende, für diverse Verbände, Unternehmen und als Berater. Wir sprechen mit ihm zunächst darüber, welche technischen Möglichkeiten es gibt, um solche Situationen zu vermeiden bzw. wie der Strom sinnvoll verwendet werden kann - von Speichern über Produktionsanpassung bis hin zu einer Steuerung der Nachfrage. Welche regulatorischen Rahmenbedingungen sind nötig, damit die technischen Lösungen zum Einsatz kommen und auf schlichte Abregelungen verzichtet werden kann.
Der jüngste Stromausfall in Spanien und Portugal, aber auch lokale Probleme oder kriegsbedingte Unterbrechungen wie in der Ukraine führen uns vor Augen, wie wichtig eine zuverlässige und permanente Stromversorgung ist. Mit dem Wechsel hin zu Erneuerbaren Energien ergeben sich dabei völlig neue Erzeugungs- und Verteilstrukturen, alte Konzepte wie Grundlast werden hinfällig.
Die aktuellen Schlagzeilen dürfen dabei nicht darüber hinwegtäuschen: Der zunehmende Anteil Erneuerbarer Energien hat dazu geführt, dass die deutsche Stromversorgung zuverlässiger geworden ist und Deutschland heute weltweit eines der Länder mit den geringsten Ausfallzeiten ist.
Unser Gast Eberhard Waffenschmidt ist Professor für elektrische Netze an der Technischen Hochschule Köln, mit dem Schwerpunkt auf Erneuerbaren Energien. Wir sprechen mit ihm darüber, wie sieht ein Stromnetz aussieht, dass überwiegend oder vollständig mit Erneuerbaren Energien gespeist wird. Welche Strukturen sind erforderlich, um ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit zu erreichen? Welchen Speichertechnologien gehört die Zukunft? Welche Lehren können wir aus vergangenen Fehlern ziehen?
Der nun vorliegende schwarzrote Koalitionsvertrag enthält einige klare Aussagen zur Energie- und Klimapolitik. die bereits für eine lebhafte öffentliche Debatte um die Zukunft der Energieversorgung sorgen. Nach der gemischten energiepolitischen Bilanz der Ampel mit großen Dezifiten vor allem im Bereich des dezentralen Ausbaus der Erneuerbaren Energien muss die neue Regierung nun dafür sorgen, dass der Wechsel hin zu den Erneuerbaren Energien unumkehrbar wird und der Mehrheit der Bevölkerung auch handfeste Vorteile bringt.
Unser Gast Susanne Jung ist Geschäftsführerin des Solarenergie-Fördervereins, der vor fast 40 Jahren gegründet wurde und heute gut 3000 Mitglieder hat, darunter sehr viele Betreiber von Dach-Solaranlagen. Wir sprechen mit ihr darüber, wieweit die im schwarzroten Koalitionsvertrag vorgesehenen Maßnahmen geeignet sind, die vorhandenen Defizite zu beseitigen. Ist Deutschland damit auf dem Weg zu 100% Erneuerbaren Energien - oder ist immer noch die Handschrift der fossilen Energiewirtschaft erkennbar? Hat die angehende Koalition verstanden, wie wichtig die breite Teilhabe an der Energieversorgung ist und wie wichtig dabei lokale Akteure sind? Welche Prioritäten sollte sich die neue Regierung setzen, um der Energiewende den nötigen Schwung zu verleihen?
Bereits seit über 140 Jahren wird die Windenergie zur Stromerzeugung genutzt. Die heutige Technologie geht auf die Pionierarbeit von zahlreichen Ingenieuren und Technikern zurück, angefangen zu Ende des 19. Jahrhunderts. Seit den 1970ern gab es in Deutschland und in vielen weiteren Ländern zahlreiche Pioniere, die sehr viele praktische Grundlagen für die heutigen Windkraftanlagen schufen.
Unser Gast Arne Jaeger arbeitet für das Deutsche Windkraftmuseum und kennt wie kein zweiter die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Viele Anlagen wurden in der Pionierzeit im Eigenbau konstruiert, einige davon konnte das Museum erwerben. Wir sprechen mit Arne über die wichtigen technologischen Meilensteine, die die Windenergie vorangebracht haben, sowie über bekannte und weniger bekannte Pioniere. Welche Rolle spielten einzelne, öffentlich geförderte Großprojekte wie Growian im Verhältnis zu persönlichen Initiativen? Wie wichtig war der internationale Austausch und wann begann die Industrialisierung der deutschen Windbranche?
Batterieelektrische Elektroautos sind auf dem Vormarsch, ihr Marktanteil steigt weltweit rapide an. Auch wenn der zusätzliche Stromverbrauch durch Elektroautos bislang kaum spürbar ist, stellt sich heute schon die Frage, wie sich die künftige Anzahl der E-Autos auf die Stromnetze auswirkt. Auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien, der inzwischen neue Rekorde erreicht, erfordert neue technische und regulatorische Rahmenbedingungen, insbesondere, wie Stromnachfrage und -angebot in Übereinstimmung gebracht werden können. Elektroautos verfügen heute schon über erhebliche Speicherkapazitäten, die genutzt werden könnten, um den Strombedarf auch dann zu decken, wenn Wind und Sonne gerade nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
Unser Gast Marco Piffaretti nimmt derzeit an einer Fachkonferenz zu dem Thema in Aachen teil. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den verschiedenen Aspekten des sogenannten bidirektionalen Ladens. Er ist einer der führenden Experten in dem Bereich und koordiniert als Operating Agent der Arbeitsgruppe der Internationalen Energieagentur, die sich mit bidirektionalen Laden befasst – Task 53, Interoperability of Bidirectional Charging (INBID). Mit ihm sprechen wir über Stand der Technik und über regulatorische Herausforderungen. Welche Rolle werden Elektroautos langfristig im Energiesystem spielen und wozu sind sie heute schon in der Lage?
In den letzten Jahren wurden die Rahmenbedingungen für Bürgerenergie-Akteure immer schwieriger und auch die Ampel-Regierung hat die Fesseln nicht gelockert. Dennoch spielt die Bürgerenergie aber nach wie vor eine maßgebliche Rolle und steht für einen erheblichen Teil der Investitionen im Energiesektor. Inzwischen setzt sich zudem die Erkenntnis durch, dass die dezentrale Energiewende eine große Chance darstellt und letztlich unabdingbare Voraussetzung für den Wechsel hin zu den Erneuerbaren Energien ist.
Andreas Herschmann kennt als Vorstandsvorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen die praktischen Aspekte und Barrieren der Energiewende aus erster Hand. Wir sprechen mit ihm darüber, welche Weichenstellungen die neue Bundesregierung vornehmen muss, damit die Menschen vor Ort die Energiewende zum Erfolg führen können, und welche Hindernisse beseitigt werden sollten. Welche Chance bietet das angekündigte Investitionsprogramm?
Mt dem vor 25 Jahren verabschiedeten Erneuerbaren Energien Gesetz EEG waren die Weichen eigentlich in Richtung 100% Erneuerbare Energien gestellt. Das Gesetz entfaltete eine einzigartige Dynamik in Deutschland und weltweit, führte zu einer enormen Ausbaudynamik, zu beeindruckenden Kostendegression und zum Aufbau einer völlig neuen Industrie. Wenn die Steigerungsraten beim Ausbau der Erneuerbaren Energien sich fortgesetzt hätten, hätte Deutschland schon vor Jahren 100% Erneuerbare Energien im Stromsektor erreicht, wie jüngste Berechnungen zeigen.
In Deutschland nahmen die Regierungen jedoch immer weitere Einschnitte am EEG vor und verlangsamten so den Ausbau erheblich. Andere Länder wie China haben in der Zwischenzeit ein wesentliche dynamischeres Wachstum entwickelt und von Deutschland die technologische Führung übernommen.
Krisztina und Stefan sprechen in dieser Folge darüber, was den Wechsel hin zu Erneuerbaren Energien aufgehalten hat. Was waren die entscheidenen Bremsen auf dem Weg zur solaren Vollversorgung? Welche Lehre müssen wir heute daraus ziehen - wie können wir 100% Erneuerbare Energien schnellstmöglich erreichen? Was sollte die nächste Bundesregierung tun? Und lässt sich der Pfad hin zur Erneuerbaren Energiewirtschaft auch ohne politische Unterstützung aber mit zivilgesellschaftlichem Engagement erfolgreich beschreiten?
Der Kreis Steinfurt hat beim Ausbau der Erneuerbaren Energien eine Vorreiterrolle, vor allem beim Ausbau der Windenergie. Um die lokale Wertschöpfung zu erhöhen, hat der Kreis schon vor Jahren Regeln für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern beschlossen. Ein großer Teil der im Kreis installierten Anlagen sind daher in lokalem Besitz, die lokale Bevölkerung wurde selbst zum Träger der Energiewende.
In der ersten Episode der dritten Staffel sprechen wir mit Silke Wesselmann, Leiterin des Amts für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, über die Wege zum Erfolg bei der Energiewende im Kreis Steinfurt, über Hindernisse, die zu überwinden waren und über ihre Erwartungen an die Bundespolitik.
Während sich einige Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien inzwischen fest im Strommarkt etabliert haben, gibt es auch neue Entwicklungen, die interessante Perspektiven für die Stromversorgung bieten.
Im Bereich der Höhenwindkraftanlagen bzw. Flugwindkraftanlagen gibt es in letzter Zeit sehr spannende Entwicklungen und erste Unternehmen bieten bereits entsprechende Produkte an. Dabei handelt es sich um Anlagen, die den stärkeren und konstanteren Wind in sehr großen Höhen nutzen.
Über den Stand der Technik, Marktpotenziale und bestehende regulatorische Hürden spreche ich mit Kristian Petrick, Generalsekretär des europäischen Verbandes Airborne Europe. Welchen Beitrag können Flugdrachen realistisch leisten und welche politischen Weichen müssen dafür gestellt werden?
Kleine Windkraftanlagen, also Windräder bis zu einer Größe von maximal 100 Kilowatt, werden heute häufig in ländlichen Gegenden genutzt. Nach Schätzungen der World Wind Energy Association sind weltweit mehr als eine Million solcher Anlagen im Einsatz, und zuletzt erfährt die Branche vor allem in den USA einen deutlichen Aufschwung. Kleinwind wird meist für Eigenverbrauch genutzt und stellt eine ideale Ergänzung für Photovoltaik dar.
Mein Gast Klaus-Dieter Balke ist Vorstand des Bundesverbandes Kleinwindkraft und beschäftigt sich auch hauptberuflich mit der Planung und Installation von kleinen Windrädern. Ich spreche mit ihm über die wichtigsten Fragen: Was muss bei der Planung und Installation von Kleinwindkraft beachtet werden? Wo liegen Fallstricke, welche bürokratischen Hürden gibt es? Welche industriellen Akteure spielen heute eine wichtige Rolle? Und was sollte die Politik tun, um diese Technologie zu unterstützen?
Die Bundesregierung hat gerade Eckpunkte vorgelegt, wie das künftige Strommarktdesign gestaltet werden soll. Auch wenn sich der Ausbau der Erneuerbaren Energien zuletzt positiv entwickelt hat, so sind doch noch erheblich Anstrengungen nötig, um in Deutschland eine Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien zu erreichen.
Auch wenn außerdem der Strompreis in den letzten Monaten spürbar zurückging, so herrscht doch sowohl bei Verbrauchern wie bei Investoren im Moment große Unsicherheit über die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland. Die jetzigen regulatorischen Rahmenbedingungen müssen dringend angepasst werden, um einem Markt mit einem hohen Anteil an variablen Erneuerbaren Energien auf der einen Seite und mit Speichern auf der anderen Seite effizient zu regeln.
Mit meinem Gast Johannes Lackmann spreche ich darüber, wie weit die aktuellen Vorschläge dem gerecht werden und was sonst noch getan werden muss, damit der Wechsel hin zu 100% Erneuerbaren Energien gelingt und Wirtschaft wie Verbraucher gleichermaßen davon profitieren. Johannes Lackmann hatte über viele Jahre leitende Funktionen in wichtigen Verbänden der Erneuerbaren Energien und ist auch seit Jahrzehnten als Investor und Betreiber tätig.