Discover Dini Mundart Schnabelweid
Dini Mundart Schnabelweid
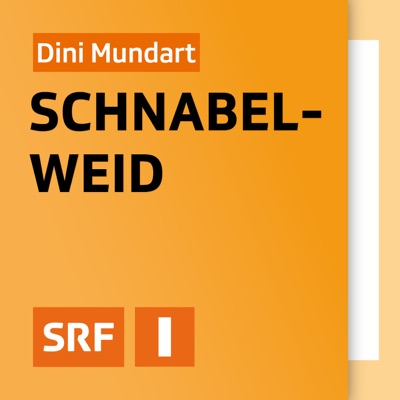
Dini Mundart Schnabelweid
Author: Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Subscribed: 277Played: 9,479Subscribe
Share
© 2024 SRG SSR
Description
«Dini Mundart – Schnabelweid» ist die Sendung für alle, die Mundart lieben. Wir bringen die Mundartvielfalt der deutschen Schweiz zum Klingen.
Lesungen von MundartautorInnen, Lieder von MundartsängerInnen, Geschichten und Beiträge zur Mundartkultur von Freiburg bis ins St.Galler Rheintal und von Schaffhausen bis zu den Walsern.
Lesungen von MundartautorInnen, Lieder von MundartsängerInnen, Geschichten und Beiträge zur Mundartkultur von Freiburg bis ins St.Galler Rheintal und von Schaffhausen bis zu den Walsern.
323 Episodes
Reverse
Der Schaffhauser Autor Andri Beyeler hat auf Mundart eine bewegende, literarische Biografie des sozialistischen Berner Druckers Fritz Jordi geschrieben – in einer besonderen, zweistimmigen Form und aufwändig illustriert.
Auf der Wanderschaft nach seiner Druckerlehre kommt der junge Berner Fritz Jordi Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland in Kontakt mit dem Sozialismus. Zurück in der Schweiz übernimmt er als überzeugter Sozialist die Druckerei des Vaters, gründet eine Genossenschaft und wird zu einem der wichtigeren Herausgeber von sozialistischen Drucksachen. Als solcher gerät er immer wieder ins Visier der Behörden. Später im Leben wendet er sich vom aktiven Sozialismus ab und gründet im Tessin eine Künstlerkommune.
Eine Mischung aus Literatur und Dokumentation
Der Schaffhauser Autor und Schauspieler Andri Beyeler beschäftigt sich schon seit über 10 Jahren mit Fritz Jordi. Zunächst widmete er sich ihm auf der Theaterbühne, nun erzählt er dessen bewegtes Leben anhand von umfassend recherchierten Dokumenten (Zeitungen, Briefe, Flugblätter, Akten) auf Mundart nach – und illustriert es mit zahlreichen Zeichnungen im Stil von Holzschnitten aus der Zeit.
Im Gespräch mit Andri Beyeler erfahren wir, was ihn an der Figur Fritz Jordi besonders beeindruckt hat, warum er sich für eine Mischform aus Literatur und Dokumentation entschieden hat, und was es mit seiner speziellen, mehrstimmigen Erzählform auf sich hat.
Eine Mischung aus Mundart und Hochdeutsch
Später in der Sendung stellen wir Ihnen das besondere Buch «Kruttingen - e Dorfgschicht» von Marianne Erne, Patricia Jäggi, Kathrin Probst und Katharina Wehrli vor. Erste Besonderheit: Die vier Frauen haben die Erzählung gemeinsam geschrieben. Jede war für die Entwicklung einer Hauptfigur zuständig. Zweite Besonderheit: Die Erzählung ist auf Standarddeutsch geschrieben, während die direkte Rede, die Dialoge auf Schweizerdeutsch verfasst sind. Warum sie sich so entschieden haben und welche Herausforderungen sich ihnen beim Schreiben gestellt haben, erzählt eine der Autorinnen, Kathrin Probst in unserer Sendung.
Zum Abschluss der Mundartstunde erwartet Sie der beliebte Briefkasten mit Fragen von Hörerinnen und Hörern zu Dialektwörtern und mit Antworten von unseren Mundartexperten. Diese Woche mit dabei: Der Flurname «Säspel» in Nunningen und der Ausdruck «Möielimuul» sowie der Familienname Reichmuth.
Buchhinweise:
* Andri Beyeler. Sang von einem Drucker und Siedler. Der gesunde Menschenversand, 2024.
* Marianne Erne, Patricia Jäggi, Mathrin Probst & Katharina Werhrli: Kruttingen - e Dorfgschicht. Edition Gaggalaariplatz, Arisverlag, 2023.
In der deutschen Sprache enthält praktisch jeder Satz ein Merkmal für «männlich» oder «weiblich». Etwa eine Personenbezeichnung wie «Sänger» oder ein Pronomen wie «ihre». Für eine non-binäre Person ist das ein gröberes Problem. Was tun?
Luca Koch kennt sich hier aus, denn Luca ist non-binär. Markus Gasser und Nadia Zollinger von der SRF-Mundartredaktion diskutieren mit Luca die vielen Möglichkeiten genderneutraler Sprache.
Wie braucht man im Deutschen das englische «they/them» oder sogenannte Neopronomen wie «hen» oder «xier»? Was sagt Luca zu Vorschlägen aus der Hörerschaft wie «äsi» oder «sier»? Soll man für eine Minderheit seine Sprache anpassen und warum fällt das vielen Menschen so schwer?
Klar wird: Was den einen ein stolpersteingepflasterter Weg, ist den anderen eine kreative Spielwiese!
Familiennamen Grossenbacher, Niederberger, Krummenacher und Holenstein
This Fetzer vom Schweizerischen Idiotikon hat aus den unzähligen Anfragen vier Familiennamen herausgepickt, deren gemeinsames Merkmal es ist, dass sie aus Ortsbezeichnungen entstanden sind und Adjektive wie «gross», «krumm» oder «hohl» enthalten.
Der Doyen der Schweizer Mundartliteratur trifft auf den aufstrebenden Luzerner Autor. Sie stellen ihre neusten Bücher vor und debattieren darüber, was für sie «Heimat» und «Kultur» bedeuten.
Pedro Lenz' Theaterstück «Längizyti, oder: furtga isch immer fautsch», welches Ende 2023 in Bern uraufgeführt wurde und jetzt gedruckt als Buch herauskommt, beschäftigt sich mit dem Begriff «Heimat». Ein Herzensthema für den Langenthaler mit spanischer Mutter.
Die Figuren im Stück – alle älteren Semesters – verhandeln den Heimatbegriff aus verschiedenen Perspektiven: Der Rentner, der nach Spanien ausgewandert war und jetzt wieder zurückgekehrt ist, und nun die alte Heimat – nachdem die meisten Beizen zugemacht haben und durch Kebap-Läden und Nailstudios ersetzt wurden – nicht mehr wiedererkennt. Der Dagebliebene, der die heimatlichen Gepflogenheiten romantisch verklärt und nicht hinterfragt. Und der Spanier, der als Kind von Gastarbeitern in die Schweiz kam und dadurch die «alte Heimat» verlor.
Schelmenroman im Kulturkuchen
«Polifon Pervers» ist Béla Rothenbühlers zweiter Roman auf Luzerndeutsch. Ein moderner Schelmenroman, eine Satire auf den Schweizer Kulturbetrieb.
Sabin und Schanti, zwei Germanistik-Studentinnen, gründen einen Verein für Kultur, pardon: für «Unterhaltung», wie sie es nennen, und fangen an, Theaterstücke und weitere kulturelle Anlässe zu veranstalten. Der eigentliche Zweck des Vereins: Von Stiftungen, Kulturförderprogrammen und Firmen so viel Geld wie möglich locker machen – und es in die eigenen Taschen fliessen lassen.
Der Verein «Polifon Pervers» eilt von Erfolg zu Erfolg: Die Produktionen werden immer grösser, die Einnahmen ebenso. Und niemand kommt den Hochstaplerinnen auf die Schliche. Gefährlich wird es erst, als Schanti das Geschäft zu diversifizieren beginnt: Sie wäscht plötzlich das Drogengeld der halben Schweizer Club-Dealerszene. Wie lange kann das nur gutgehen?
Gespräch über Heimat und Kultur
Anlässlich der Solothurner Literaturtage treffen sich Pedro Lenz und Béla Rothenbühler live vor Publikum zum Gespräch: Es geht um ihre beiden Bücher und davon ausgehend um die Begriffe «Heimat» und «Kultur» (oder «Unterhaltung»?). Und natürlich lesen die beiden in dieser einstündigen Sendung auch aus ihren Büchern vor.
Buchhinweise:
* Pedro Lenz: Längizyti. Drama, Cosmos Verlag 2024. 104 Seiten.
* Béla Rothenbühler: Polifon Pervers. Roman, Der gesunde Menschenversand 2024. 220 Seiten.
Haben Sie eine Frage zu Mundartwörtern oder Ausdrücken? Bringen Sie Ihre Frage ein! Unsere Mundartexperten beantworten möglichst viele davon live im Studio.
Woher kommt der Ausdruck «Hans was Heiri»? Wie kommt man darauf, dem Hageln «ziboldere» oder «ziböllele» zu sagen? Warum sind manche alte Mundartwörter in einigen Dialekten verschwunden, in anderen aber noch lebendig? Fragen über Fragen...
Und in dieser Sendung gibt es Antworten! Gabriela Bart und Sandro Bachmann vom schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon sowie SRF-Mundartredaktor André Perler sind zwei Stunden lang live im Studio, recherchieren und beantworten so viele Fragen wie möglich.
Fragen: live oder per Sprachnachricht
Schicken Sie Ihre Frage vor der Sendung als WhatsApp-Sprachnachricht an die Nummer 079 132 132 1! Oder rufen Sie live in die Sendung an! Wir drücken die Daumen, dass Sie eine Antwort auf Ihre Frage erhalten.
Achtung: Diesmal werden nur Wörter und Wendungen erklärt, keine Orts- oder Familiennamen.
Was unterscheidet Dialekte am meisten: die Wortformen, die Grammatik, die Betonung? Es ist eindeutig die Lautung der Wörter. Um diese drehen sich die heutigen Mundartfragen.
Warum sagt man schweizerdeutsch Staubsuuger und nicht Stuubsauger? Wo sagt man Määl, wo Meel? Kann man statt gwüsst auch gwüsse sagen? Und wie entstehen Formen wie gfinde und gmerke?
Fragen nach der Lautung sind eher untypisch bei Dini-Mundart-Schnabelweid. Die meisten Hörerinnen und Hörer interessieren sich für Worte und Wendungen. Entscheidend fürs Erkennen von Mundarten sind aber Lautvarianten bei der Aussprache. Zu erkennen sind diese auch bei der jeweils regionalen Art hochdeutsch zu sprechen. Christian Schmutz ist bei Dani Fohrler im SRF1-Studio und beantwortet live Hörerfragen zum Thema.
Im zweiten Teil erklärt Idiotikon-Redaktor Martin Graf den Familiennamen Scherz. Und zum Schnabelweid-Magazin gehört jeweils auch ein aktueller Musiktipp aus der SRF-Musikredaktion.
Wer Deutsch als Fremdsprache lernen muss, kann an den Artikeln verzweifeln. Oder warum sagt man «DAS Mädchen», obwohl das Wort eine junge Frau bezeichnet? Umgekehrt heisst eine Gruppe von Sport treibenden Männern «DIE Mannschaft». Wo ist da die Logik?
Über diese Frage diskutieren Nadia Zollinger und Markus Gasser von der SRF Mundartredaktion.
Die schlechte Nachricht: «Es gibt kein allumfassendes System von Regeln, nach dem man das Genus der Substantive voraussagen kann.» Zitat Duden. Die gute Nachricht: Es stimmt nicht, dass man das grammatische Geschlecht von jedem einzelnen Wort lernen muss. Viele überraschende Faustregeln helfen Muttersprachlern intuitiv, den korrekten Artikel zu benutzen. Schwierig wird es gelegentlich bei eingedeutschten Anglizismen: «Email», «App» und «SMS» schwanken beispielsweise zwischen «die» (eher in Deutschland) und «das» (eher in der Schweiz). Ein tiefer Blick in die deutsche Grammatik, der spannende Wort- und Kulturgeschichten offenbart.
Familiennamen mit weiblichen Rufnamen
Die Familiennamen Agner, Barblan, Item, Eller und Serena sind Mutternamen, d.h. sie sind aus einem weiblichen Rufnamen entstanden sind, nämlich Agnes, Barbara, Juditha, Elisabeth und Serena - wobei die Familiennamen häufig aus Kurzformen dieser Rufnamen gebildet worden sind.
Der Prättigauer Journalist und Autor Conradin Liesch hat ein Buch mit Geschichten und Liedern seiner verschrobenen Kunstfigur Bartli Valär herausgebracht.
Bartli Valär ist ein Bergbauer aus dem Prättigau. Sein Alltag spielt sich zwischen dem Hof, seiner Frau Annädeti, dem Rapid und der Beiz auf der anderen Strassenseite ab. Er jodelt gern, aber nicht gut, er trinkt viel und hat einen eher einfachen Blickwinkel auf die Welt.
Vor allem aber ist Bartli Valär eine Erfindung des Autors Conradin Liesch, der selbst aus dem Prättigau stammt. Bartli, der in breitestem Prättigauer Dialekt seine gern leicht übertriebenen Geschichten erzählt, ist für seinen Autor klar eine Parodie auf das Leben auf seiner «eigenen Scholle» Prättigau – die er sehr liebt, wie er sagt.
Inwiefern der verschrobene Bartli für den Journalisten Conradin Liesch ein Ventil ist, was ihn an der Übertreibung reizt, und was den Prättigauer Dialekt für ihn ausmacht, darüber gibt der Autor im Gespräch Auskunft, er liest auch Geschichten aus dem Buch vor.
Ausserdem erklären wir in der Sendung das Wort «sobänd», den Hofnamen Vitzhuus sowie den Familiennamen Haus, und wir stellen ein Projekt des Wallisers Volmar Schmid vor, der für jede Oberwalliser Gemeinde eine Sage gesammelt hat.
Hinweise:
* Bartli Valär: Geborä zum Heuä. Somedia Buchverlag 2024.
* Projekt «Enkeltauglichkeit» von Volmar Schmid: Link
Doris Walser und Andreas Rindisbacher haben Erinnerungen aus ihrer Kindheit und Jugend in Rehetobel AR aufgeschrieben - im Appenzeller Dialekt und auf Hochdeutsch - und als Buch herausgegeben.
In den erinnerten Geschichten von Doris Walser und Andreas Rindisbacher leben die 1950er- und 60er-Jahre wieder auf. Es geht darin meist um Alltägliches (die vielen Quartierlädeli, der Schulunterricht, die Stickereiarbeit im Dorf).
Das ist durchaus lesenswert, denn im Vergleich mit heute wird man sich der vielen Veränderungen, aber auch der Konstanten bewusst.
Erinnern, aufschreiben und teilen
Im Gespräch mit Mundartredaktor André Perler reden Doris Walser und Andreas Rindisbacher über das Aufwachsen in Rehetobel AR, über das (manchmal fehlerhafte) Erinnern, über den Rückblick zwischen Romantik und Realismus und darüber, wie es ist, diese Erinnerungen mit einem Publikum zu teilen.
Und natürlich kommt die Sprache auch auf den den Appenzeller Dialekt, der in Ausserrhoden heute einen schweren Stand hat.
Mundartwörter und Familiennamen
Im Schnabelweid-Briefkasten gibt es wie immer Antworten auf Mundart- und Sprachfragen aus der Hörerschaft, so etwa zur Herkunft und Bedeutung der Familiennamen Hag und Hager.
Buch-Tipp:
Doris Walser und Andreas Rindisbacher: Loschtegi, schreegi ond himmeltruurigi Gschichte. Im hiesige Dialekt, fö die wos veschtöönd, für alle anderen auf Hochdeutsch. Verlag Druckerei Appenzeller Volksfreund, 2024. 195 Seiten.
Ostern ist nicht nur kulinarisch ein Spektakel nach der Fastenzeit, sondern auch sprachlich. Ausser über Wortklassiker wie «Ostern», «Karfreitag» und «Äiertütschis» diskutieren Nadia Zollinger und Markus Gasser auch über weniger bekannte Begriffe wie «öschterle» oder «Osterzettel».
Zudem machen die beiden einen Abstecher nach Australien. Dort konkurrenziert seit den 1970er Jahren ein einheimisches Tier den Osterhasen. Das neue Osterpersonal heisst «Bilby», hat zwar auch lange Ohren, hüpft aber wie ein Känguru. Was hat seine steile Karriere ermöglicht? Und wer ausser dem Hasen brachte früher bei uns die Ostereier? Kleiner Spoiler: Eine Variante für «Oschternäscht» war früher «Guggernäscht».
Eine Sendung mit überraschenden Erkenntnissen zu «Osterwörtern».
Wie kommt der Hafer in Familiennamen?
Sprachexperte Hans-Peter Schifferle erläutert die drei Familienamen Habermacher, Haberstich und Wildhaber. Alle drei gehen auf das Getreide «Hafer» in seiner früheren Aussprache «Haber» zurück - allerdings auf sehr unterschiedliche Art.
Seit seiner Pensionierung übersetzt der reformierte Pfarrer Hansjakob Schibler Bibelstellen auf Baseldeutsch und in Versform. So sind auch eine Reihe Passions- und Ostergedichte entstanden. Zum Gründonnerstag liest Pfarrer Schilber einige Verse vor, erzählt von der Entstehung und deutet die Inhalte.
Das Dichten hat Hansjakob Schibler immer schon interessiert. Und die baseldeutsche Sprache auch. Schon früh hat er mit «Schnitzelbängg» angefangen. Als Pfarrer hat er bei Trauungen jeweils die Liebesgeschichte seiner Brautleute in Versform erzählt. Und auch seinen Konfirmandinnen und Konfirmanden hat er Bibelwissen auf gereimte Weise vermittelt. Seit seiner Pensionierung vor zehn Jahren wagt er sich nun an zentrale Bibelstellen heran. Dabei geht es ihm nicht nur um einen adäquaten baseldeutschen Ausdruck, sondern auch um eine Interpretation der betreffenden Bibelstellen, die auch im Gottesdienst eine Anwendung findet. Im Gespräch mit Literaturredaktor Michael Luisier berichtet er von der Entstehungsweise und den Inhalten seiner Übersetzungen und entpuppt sich dabei als überaus engagierter Theologe und Lyriker.
Die Berner Autorin Stef Stauffer erzählt ein ganzes Leben in Mundart – über vier Romane hinweg. Der vierte und letzte Teil dieser Lebensgeschichte dreht sich ums Älterwerden der namenlosen Protagonistin und um eine letzte grosse Reise.
Die Erzählerin in Stef Stauffers Romanen (hören Sie hier die Sendungen zum ersten , zweiten und dritten Teil nach) hat keinen Namen, und «Ich» sagt sie auch nie. Sie spricht von sich in der unbestimmten, dritten Person als «me» (auf Hochdeutsch: «man»).
Im vierten und letzten Teil wird «man» alt, lebt in einer Alterssiedlung am Stadtrand, hat die Übergabe des Eigenheims geregelt und regt sich gelegentlich über die anderen Alten in der Umgebung auf. So lange, bis die Protagonistin sich aus einer Laune heraus entschliesst, mit drei jungen Männern auf eine letzte (oder vorletzte, wer weiss) grosse Reise nach Barcelona aufzubrechen.
Die Aufmüpfigkeit und der leise Schalk von Stef Stauffers Protagonistin sind auch im Alter noch nicht verblichen: Ein ebenso heiterer wie einfühlsam geschriebener Roman über den letzten Teil des Lebens.
In der Sendung sprechen wir mir Stef Stauffer über den Abschluss ihres Lebensgeschichte-Projekts, darüber, warum man nicht «man» sagen sollte, und über Mundart als absichtlich umständliche Schreibsprache. Ausserdem erklären wir die Ausdrücke «Chrutwäiemändig», «chögle» und «ziggle» sowie den Familiennamen Diethelm.
Hinweise:
* Stef Stauffer: Affezang. Zytglogge 2024, 166 Seiten.
* Buchvernissage: 5. April 2024, 20:30 Uhr, Bären Münchenbuchsee .
* Den ersten der vier Romane («Hingerhang») hat Stef Stauffer für SRF komplett als Lesung aufgenommen. Die können Sie hier hören.
Ungefähr jedes vierte deutsche Wort ist irgendwann aus einer fremden Sprache entlehnt worden. Heutige Fremdwörter stammen zu 80% aus dem Englischen. Wir passen sie allerdings schnell an unser System an und sprechen zum Beispiel vom «crazygschte Bröntsch ever». Das ist Englisch in deutschem Gewand!
Nicht alle Kulturen und Länder sind gleich offen für Fremdwörter. In Deutschland gab es vom 18. Jahrhundert an bis Mitte des 20. Jahrhunderts eine regelrechte Hetzjagd vor allem auf Romanismen. Frankreich und Island wiederum sind zwei Länder, in denen auch heute Anglizismen aktiv bekämpft werden. In Island etwa kreiert eine Sprachkommission auch für technische Neuerungen isländische Entsprechungen. Der Computer heisst dort «tölva», wörtlich «die Zahlenseherin». Sprachpflege kann poetisch sein!
Vom Übernamen zum Familiennamen: Wyrsch
Der Familienname Wyrsch oder Würsch geht von einem Übernamen aus, der zum Adjektiv wirrisch, wirrsch mit der Bedeutung 'zornig, rappelköpfig, verschroben, verwirrt' gebildet ist. Der Familienname ist in Nidwalden seit dem frühen 14. Jahrhundert bezeugt; von dort aus hat er sich nach Uri und später in den Aargau ausgebreitet. Heute heissen in der Schweiz etwa zweieinhalbtausend Personen Wyrsch oder Würsch, ziemlich genau die eine Hälfte davon schreibt sich mit -y-, mit -ü- die andere.
Sprache ist voller Wortzusammensetzungen – Deutsch und Schweizerdeutsch besonders. Rund um Fragen der Hörerinnen und Hörer gibt es tolle Geschichten zu entdecken. Alles eigene Kompositionen.
Was hat der Fuss in der Steuer zu tun, was der Stiefel im Sinn? Jedenfalls sprechen wir von Steuerfuss und stiefelsinnig und kennen den Weg solcher Zusammensetzungen nicht. Oder warum nehmen wir den Boden auf, wenn wir fegen? Auf Deutsch kann man einfach alles zusammenhängen und zum Beispiel die Vierwaldstätterseedampfschifffahrtskapitänsmützenkordel machen (falls das noch jemand lesen kann). Aber was steckt hinter dem Zusammenspiel von Grundwort und Bestimmungswort? Sind sie alle logisch?
Sogenannte Komposita führen durch das heutige Dini-Mundart-Magazin. Mundartredaktor Christian Schmutz ist live bei Mike LaMarr im Studio. Er zeigt anhand der Hörerfragen das Überraschungspotenzial auf.
Im zweiten Teil des Magazins ist Dabu Fanastic zu hören, ein aktueller Musiktipp aus der Mundartwelt, sowie der Familiennamen Gunzinger zu entdecken.
Die Region Appenzell-Toggenburg hat eine besondere Mundart. Dort sagt man Sätze wie «Hoptsach de Hond esch gsond» oder Wörter wie «Täghüffeli» für die Hagebutte. Was diese Gegend sprachlich sonst noch speziell macht, entdecken Nadia Zollinger und Markus Gasser in ihrer Serie «Dialektratis».
Die genannten Beispiele zeigen: Es gibt Erkennungsmerkmale, die für den Kanton Appenzell Ausserrhoden, den Kanton Appenzell Innerrhoden und für das Sanktgallische Toggenburg gemeinsam gelten. Doch beim genaueren Hinhören finden sich fast so viele Unterschiede wie Gemeinsamkeiten.
Allein in den beiden Appenzeller Halbkantonen haben Linguisten neun Sprachschranken eruiert. Wer Innerrhödler von Ausserrhödlerinnen unterscheiden will, muss also ganz genau hinhören. Zudem vermeldet die Hörerin Erika Michel aus Nesslau, dass «ein Toggenburger kein Appenzeller ist»!
Nadia und Markus gehen den Unterschieden auf den Grund und kommen unter anderem bei der «Wedegeente», dem «Töbeli» und dem «Aacheholz» vorbei. Dabei helfen ihnen bekannte und unbekannte Appenzeller und Toggenburger Stimmen.
«Sönd wöllkomm!»
Familiennamen, die aus dem Personennamen Heinrich entstanden sind
Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon erläutert die Familiennamen Heini, Heinzer, Heierli und Heiri. Sie allen gehen in der einen oder anderen Art auf den im Mittelalter besonders häufigen Rufnamen Heinrich zurück. Ihren geografischen Ursprung haben die vier Familiennamen aber jeweils an ganz verschiedenen Orten der Schweiz.
Neben den berühmten «Schnitzelbängg» hat die Basler Fasnacht noch weitere Ausdrucksmittel. Eines davon sind die sogenannten «Cliquezeedel», auf denen man all das verewigt findet, was die Baselerinnen und Basler seit der letzten Fasnacht bewegt hat.
«Zeedel» sind lange Papierstreifen, die von den Basler Fasnachtscliquen am Strassenrand verteilt werden und auf denen gereimt und in Versform das jeweilige «Sujet» präsentiert wird. Also das Thema, das die einzelnen Cliquen ausspielen. Davon gibt es wie immer genug: Der Klimawandel und die Künstliche Intelligenz, die beiden Hauptthemen der diesjährigen Basler Fasnacht, aber auch Ausgefalleneres oder Leichteres wie der Barbie-Film, der Generationenkonflikt oder das Basler Kulturleben und Beizensterben. Am Tag nach der Basler Fasnacht präsentiert «Dini Mundart» eine Zeedellesung mit den Höhepunkten des aktuellen Jahrgangs. Wie gewohnt mit dem Schauspieler Urs Bihler als Sprecher.
Die Schweizer Autorin Sarah Elena Müller produziert zusammen mit der Sängerin Milena Krstic «Spoken Pop» auf Berndeutsch. Von ihnen erscheint das neue Album «Brutto Inland Netto Super Clean» samt illustriertem Textbuch. Ein faszinierender Fiebertraum.
Am Anfang ihrer Produktionen stehen Gedichte, die Sarah Elena Müller (nominiert für den Schweizer Buchpreis 2023) auf Hochdeutsch schreibt. In einem eng verwobenen Probe- und Produktionsprozess stückelt Milena Krstic diese Texte neu zusammen und übersetzt sie spontan ins Berndeutsche, während Sarah Elena Müller Musik und Beats dazu produziert.
So entstehen eindringliche, teils auch absichtlich im Ungeschliffenen belassene Texte über Existenzielles, zum Beispiel übers Verlorensein im Hier und Jetzt: «Was hesch du hie verlore? / Du bisch verlore! Hie! Itz!», heisst es im Titelsong «Brutto». Was sie auszeichnet, ist eine abenteurliche Bildhaftigkeit, die im Buch zum Album noch verstärkt wird durch die Illustrationen des Schweizer Künstlers Luca Schenardi.
Auch sprachlich sind die spontan ins Berndeutsche übersetzten Texte besonders: Anglizismen und Teutonismen beispielsweise sind für Sarah Elena Müller und Milena Krstic kein Tabu. «Ich will kein manieriertes, berndeutsches Lied, das sich um berndeutsche Formalitäten dreht – ich will ein Lied, das einen lyrischen Inhalt hat und mit dem Charme des Berndeutschen spielt», sagt die Autorin Sarah Elena Müller im Interview. Die Mundart ist für Cruise Ship Misery kein Selbstzweck, sondern etwas, das «einfach so passiert» ist, wie die beiden Künstlerinnen sagen.
In der Sendung erklären Sarah Elena Müller und Milena Krstic, wie Cruise Ship Misery zur Mundart kam, sie beschreiben ihre gemeinsame Arbeit und erörtern, wie viel Erklärung das Publikum bei anspruchsvollen Texten braucht.
Ausserdem erklären wir den Mundartausdruck «Guggemusig», die Flurnamen «Iverturst» und «Iverplut» sowie den Familiennamen Ulmann, und wir stellen die neu aufbereitete Website sprachatlas.ch vor.
Anmerkung:
Der Nachname von Milena Krstic müsste korrekterweise mit einem Akutakzent auf dem «c» geschrieben werden. Unsere Online-Plattform lässt dieses Sonderzeichen bedauerlicherweise immer noch nicht zu. Wir bitten um um Entschuldigung dafür.
Hinweise:
* Cruise Ship Misery (Sarah Elena Müller & Milena Krstic): Brutto Inland Netto Super Clean. Der gesunde Menschenversand 2024.
* Sprachatlas der deutschen Schweiz online: www.sprachatlas.ch
Orte heissen nicht zufällig so wie sie heissen. Wie sie zu ihren Namen kamen, erforscht die Namenkunde. Zu den Siedlungsnamen im Kanton Zürich gibt es jetzt ein umfangreiches Lesebuch - mit ca. 2'000 Namendeutungen.
Warum heissen Orte so wie sie heissen? Bei erstaunlich vielen Siedlungsnamen lässt sich diese Frage beantworten. Denn die Orte heissen nicht zufällig so. Jeder Name hat eine Geschichte, die in manchen Fällen über tausend Jahre zurückreicht.
2016 bis 2022 hat sich ein Forschungsteam an der Uni Zürich und am Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon mit ca. 3'700 Siedlungsnamen im Kanton Zürich beschäftigt. Die Deutungen sowie alte Namenbelege sind auf der Webseite ortsnamen.ch für alle zugänglich.
Gespräch über Siedlungsnamen
Nun hat die Redaktionsleiterin des Forschungsprojekts, Inga Siegfried-Schupp ein Buch veröffentlicht, in dem ca. 2'000 der 3'700 Zürcher Siedlungsnamen erklärt werden. Die Namen werden auch in Motivationskategorien eingeteilt, so können sie sich etwa auf den Gründer, den Besitzer oder die Lage der Siedlung beziehen oder auch auf Bodenbeschaffenheit, Flora oder Fauna vor Ort.
In der Sendung erklärt die Namenforscherin Inga Siegfried einige Zürcher Siedlungsnamen und erzählt auch, wie man der Herkunft der Namen auf die Schliche kam. Ausserdem führt sie aus, was die Siedlungsnamenlandschaft des Kantons Zürich ausmacht und inwiefern sie sich von jener anderer Kantone unterscheidet.
Mundart-Briefkasten: «öppedie» und «Tschife»
Ausserdem in der Sendung: Wie könnte es zum Mundartwort «Tschife» für einen ausgelatschten, schlechten Schuh gekommen sein? Warum sagen wir eigentlich «öppedie» für 'ab und zu'? Und steckt im Familiennamen Diener wirklich ein Untergebener? Die Antworten zu diesen Hörerinnen- und Hörerfragen gibt es im zweiten Teil der Mundartstunde.
Buch-Tipp:
Inga Siegfried-Schupp: Von Angst und Not bis Zumpernaul. Siedlungsnamen im Kanton Zürich. Chronos-Verlag, 2024.
«Nach dem Coiffeurbesuch eine miesere Frisur haben als vorher». Für diese frustrierende Situation existiert im Japanischen ein präzises Wort: «age-otori». Auf Deutsch muss man das mit vielen Wörtern umschreiben. Sagt diese Wortschatzlücke etwas über uns aus?
Eher nicht, denn solche Lücken sind meistens zufällig. Ebenso wie die Tatsache, dass Deutsch kein Wort hat für «genug getrunken haben». Nadia Zollinger und Markus Gasser von der SRF-Mundartredaktion diskutieren zufällige und systematische Wortschatzlücken.
Die Hörerschaft hat sehr kreative Vorschläge geschickt, wie Leerstellen gefüllt werden könnten. Wer genug getrunken hat, kann zum Beispiel «trinksatt», «entdurstet», «hydriert» oder «glugg» sein. Natürlich darf man auch beim altbewärten «i ha gnue» bleiben.
Familiennamen Gossweiler, Messikommer und Wildberger
Hans-Peter Schifferle, ehemaliger Chefredaktor beim Schweizerdeutschen Wörterbuch, erklärt drei Familienamen, die auf Orte im Zürcher Oberland zurückgehen. Es sind sogenannte Herkunftsnamen.
Personen mit dem Familiennamen Gossweiler haben ihren Namen vom Gehöftnamen Gosswil (mundartlich Goosswiil) in Turbenthal im zürcherischen Tösstal.
Messikommer ist zum Siedlungsnamen Mesikon gebildet. Mesikon (mundartlich Mesikche) liegt auf dem Gemeindegebiet einerseits von Illnau, andererseits von Fehraltdorf.
Wildberger schliesslich geht auf den Siedlungsnamen Wildberg (der in der deutschen Schweiz und in Süddeutschland mehrfach vorkommt) zurück. Am naheliegendsten ist wohl die Herkunft aus dem zürcherischen Dorf Wildberg im Tössbergland.
Woher kommen unsere Wörter? Dieser Frage ist der Autor und Wörterbuchschreiber Viktor Schobinger für die Zürcher Mundart nachgegangen. «züritüütschi wùùrzle» heisst sein «etimologisches wörterbuech». Und er beschreitet damit Neuland!
Etymologische Wörterbücher erzählen von der Herkunft und Entwicklung einzelner Wörter. Das heisst, sie verfolgen ein heutiges Wort zurück bis zu seinen Wurzeln, etwa in der rückerschlossenen Ursprache «Indoeuropäisch», auf die fast alle unsere europäischen Sprachen zurückgehen.
Viktor Schobinger kehrt die Perspektive in seinem Wörterbuch um: Er geht von einer indoeuropäischen Wurzel aus und zeichnet nach, welche Wörter in der heutigen Mundart aus dieser Wurzel entstanden sind - teilweise mit Umwegen über andere Sprachen.
So finden wir im Stammbaum der Wurzel «*uid» Wörter wie «wüsse», «witz», «wiis», «visuell», «provisoorisch», «idool», «Druid» oder «Sowjet». Alle mit ihrer je eigenen sprachlichen Entwicklungslinie. Den «Sprachgwundrigen», wie Viktor Schobinger im Gespräch mit SRF-Mundartredaktor Markus Gasser sagt, erschliessen sich überraschende Zusammenhänge.
Eine sehr spezielle «letzte Reise»
Zugleich mit dem dreibändigen Wörterbuch hat Viktor Schobinger, der in diesem Jahr 90 Jahre alt wird, ein dünnes Bändchen herausgegeben mit dem Titel «d räis uf rütti». Die darin erzählte Geschichte handelt vom historisch realen Graf Friedrich von Toggenburg, der 1436 starb.
Im Text erlebt sein Geist die Überführung seiner sterblichen Überreste von Feldkirch nach Rütti im Zürcher Oberland mit und zieht im Lauf dieser siebentägigen Reise Bilanz über sein Leben. Und mit ihm macht das auch der Autor, dem es nach der Fertigstellung des Textes viel besser ging als davor, wie er im Interview sagt. Weil er feststellte, wie schön es ist zu leben!
Worterklärungen zu «belauschen», «Üedeli» und «Seeholzer»
Simon Leuthold von der SRF-Mundartredaktion hat sich der Frage von Nathalie Zollinger het angenommen, die wissen wollte, ob es ein schweizerdeutsches Wort für hochdeutsch «belauschen» gibt. Die überraschende Antwort ist: Nein! Aber interessante Varianten hat er trotzdem gefunden.
Ausserdem erklärt er den Flurnamen «Üedeli» in Münchenbuchsee im Kanton Bern, nach dem Johanna Siegentaler fragt. Und Sandro Bachmann, Redaktor beim Schweierdeutschen Wörterbuch, hat zum Familiennamen «Seeholzer» recherchiert und herausgefunden, dass er auf einen Wald beim Türlersee im Zürcher Knonaueramt zurückgeht.
Buchtipps
* züritüütschi wùùrzle. etimologisches wörterbuech. en versuech vom Viktor Schobinger. züri - 2023 - schobinger-verlaag. 3 Bände, 1500 Seiten, inkl. Registerband. Preis auf Anfrage
* d räis uf rütti. vom viktor schobinger. züri - 2024 - schobinger-verlaag. 51 Seiten.
Buchbestellungen über www.zuerituetsch.ch oder direkt bei der Buchhandlung blex in Zürich (www.blex.ch )
«Viel mehr als Läppli». So könnte man das Buch, das eben über die Basler Familiendynastie Rasser erschienen ist, am besten zusammenfassen. Beschreibt es doch nicht nur drei Generationen einer Basler Künstlerfamilie, sondern auch beinahe hundert Jahre Schweizer Kabarettgeschichte.
Am Anfang steht natürlich mit Alfred Rasser, Kabarettist und Schauspieler, Mitglied des legendären Cabaret Cornichon in Zürich und Gründer des Cabaret Kaktus in Basel, der vor allem mit seinem HD Läppli Schweizer Film- und Kabarettgeschichte geschrieben hat. Doch ist das nur ein Drittel der Geschichte, die dieses wunderbar gestaltete und minutiös recherchierte Buch von René Lüchinger und Brigitta Willmann erzählt. Auf Alfred folgt nämlich sein Sohn Roland Rasser, der Gründer der Theater «Fauteuil» und «Tabourettli» am Basler Spalenberg, wo Künstler wie Franz Hohler, Dimitri, Hans Dieter Hüsch und Georg Kreisler ein- und ausgingen. Und auf ihn dann seine Kinder Caroline und Claude Rasser, die mit Gast- und Lustspielen, Märchen und dem «Pfyfferli» das Unternehmen erfolgreich ins 21. Jahrhundert geführt haben. «Dini Mundart» erzählt die Geschichte der Rassers und streift dadurch auch fast hundert Jahre Schweizer Kabarettgeschichte. Angereichert mit vielen Trouvaillen aus dem SRF-Radioarchiv.
Buchangaben:
René Lüchinger, Brigitta Willmann. Rasser - Kabarett Schweiz. 376 Seiten, 268 teils farbige Abbildungen. Christoph Merian Verlag, 2023.




