Discover Bundestalk - Der Politik-Podcast der taz
Bundestalk - Der Politik-Podcast der taz
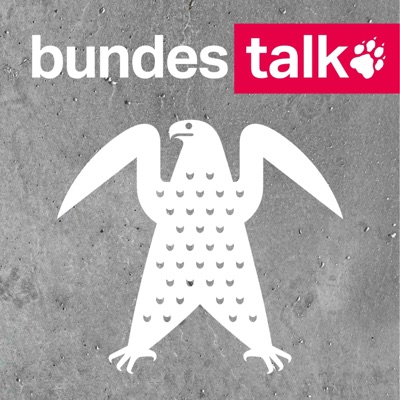
202 Episodes
Reverse
Wie in jedem Jahr geht der Bundestalk mit einer Sonderfolge in die Weihnachtspause. Fünf Personen diskutieren bei Stollen, Plätzchen und Wein fünf Thesen zum vergangenen Jahr. Das ist intensiv, manchmal erregt, manchmal auch lustig - und geht fast zweieinhalb Stunden lang.
Zur debatte hat sich das gesamte Bundestalk-Moderationsteam in dem kleinen Podcast-Studio versammel. - also: Auslandtagsredakteur Bernd Pickert, Martina Mescher vom Politikteam der Wochentaz, Stefan Reinecke und Sabine am Orde aus dem taz-Parlamentsbüro sowie als Special-Guest Wirtschaftsfachfrau Ulrike Hermann.
Die Thesen reichen thematisch vom "Maga-Faschismus", dem Abstieg Europas und der chinesischen Herausforderung für die deutsche Wirtschaft bis zu den Fragen, ob die Kombi aus Sozialdemokratie der 1970er Jahre und Popkultur als Erfolgsrezept für die Linke reicht und Merz als Außenkanzler vielleicht gar nicht ist. Da allerdings war der Widerspruch groß.
Wir hatten Spaß, Ihr habt ihn hoffentlich auch. Schöne Feiertage!
In Chile hat Jose Antonio Kast die Wahl gewonnen. Die Linke, vor ein paar Jahren mit viel Hoffnungen gewählt, hat verloren. Denn Angst vor Migranten und vor Kriminalität sind nicht nur in Chile beherrschende Themen. Sie nutzen den Rechten. Zudem droht Trump Ländern wie Mexiko und Venezuela offen militärische Interventionen an. US-Militär hat fast 100 Menschen vor allem aus Venezuela auf offener See ermordet, die sie als Drogenschmuggler verdächtigen. Auf den Kopf von Nicolas Maduro, den autoritär regierende Präsidenten von Venezuela, haben die USA ein Kopfgeld von 50 Millionen ausgesetzt. Kehren die USA unter Trump zu der alten Hinterhof-Politik zurück? Ein finsteres Bild. Es gibt auch ein paar Hoffnungszeichen. Mexikos linke Präsidentin Claudia Sheinbaum zeigt, das es möglich ist, auf Trumps Drohungen rational zu antworten.
Donald Trump hat eine Nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt – und halb Europa ist alarmiert. Denn diese Strategie ist ein Angriff auf die EU. Die Staaten Europas werden, so das Papier, von Migranten überrollt, sie sind wirtschaftliche kaputt und werden von der EU ruiniert. Das Ganze liest sich wie ein Wahlkampfrede von Alice Weidel. Zu Russland kaum ein kritisches Wort. Ist nur die übliche dampfende Trump-Rhetorik - oder wirklich die Drohung dass mit US-Hilfe Rechtsradikale von Madrid bis Berlin nach der Macht greifen sollen? Europa muss endlich begreifen, dass es einer neuen Welt lebt - einer Ordnung nach dem Untergang des alten Westens.
Wer sind die Grünen und wo stehen sie? Beim ersten Parteitag nach der Bundestagswahl ging es für die Grünen um Selbstfindung und strategische Ausrichtung. Viel Zeit bleibt ihnen dafür nicht, 2026 stehen fünf Landtagswahlen an. Den Auftakt macht im März Baden-Württemberg, wo Cem Özdemir Ministerpräsident werden will, und mit hohen Umfragewerten für die CDU und der Krise der Autoindustrie zu kämpfen hat.
Klimaschutz muss sozial sein, darüber waren sich die Grünen bei der Bundesdelegiertenkonferenz einig. Und wollen dafür auch die die Reichen zur Kasse bitten. Rückkehr zum 9-Euro-Ticket, Steuern für Privatjets und keine Gasbohrungen vor der Insel Borkum lauten die Beschlüsse. Gestritten wurde beim Parteitag auch, zum Beispiel bei der Debatte über den Wehrdienst. Am Ende stimmten die Grünen für eine Musterungspflicht, gegen den Willen der Grünen Jugend.
In den letzten Jahren prägten Annalena Baerbock und Robert Habeck einen Mitte-Kurs der Partei. In Zeiten des Rechtsrucks sei links für ihn kein Schimpfwort, sondern ein Auftrag, sagte Co-Parteichef Felix Banaszak. Zumindest klimapolitisch sind die Grünen bei diesem Parteitag nach links gerückt.
Vor einer Woche ist ein angeblicher Friedensplan der USA für die Ukraine bekannt geworden, der für das überfallene Land viele Grausamkeiten enthält, darunter Gebietsabtretungen, Reduzierung der Streitkräfte, der Verzicht auf eine Mitgliedschaft in der Nato. Die weit verbreitete Einschätzung: Die Umsetzung dieses Plans wäre ein Diktatfrieden, der den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands belohnt und das angegriffene Land bestraft.
Seitdem wird viel verhandelt und telefoniert, die anfangs 28 Punkte wurden teils gestrichen, teils überarbeitet. Die Dinge sind in Bewegung gekommen, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass Putin bereit ist, über die neue Liste überhaupt zu verhandeln. Könnte aus dem Ganzen trotzdem etwas Positives entstehen? Wieviel Handlungsspielraum hat die Ukraine noch? Was bedeutet der Machtkampf in der Trump-Administration für den Konflikt? Und sind die Europäer, ist Deutschland nun endlich bereit wirklich anzuerkennen, dass sich die transatlantischen Beziehungen unumkehrbar verändert haben?
Darüber diskutieren in der neuen Folge des Bundestalks die Leiterin des Auslandsressorts Barbara Oertel, US-Redakteur Leon Holly und Stefan Reinecke aus dem Parlamentsbüro der taz. Sabine am Orde moderiert.
Scheinbar aus dem Nichts ist Debatte um das Rentenniveau entstanden, die für Schwarz-Rot zur existentiellen Krise werden kann. Die SPD will ein höheres Rentenniveau über 2031 hinaus, die Junge Union will es senken. Die SPD fühlt sich erpresst, die JU von Merz verraten, der Kanzler mal wieder missverstanden. Klar ist:
53 Prozent habe nur die gesetzliche Rente. Um künftig Altersarmut zu verhindern, braucht es eine echte Rentenreform und eine großen Wurf. Nur - wie soll es den geben können, wenn Schwarz-Rot schon an einem vergleichsweise kleinen Problem scheitert?
Diese Woche hat die UN-Klimakonferenz in Brasilien begonnen, in Belém in der Amazonas-Region, wo der Regenwald auf der Kippe steht. Fast genau zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen fragt sich: Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz? Inzwischen ist die Welt eine andere geworden, Donald Trump, der den Klimawandel für einen Schwindel hält, regiert in den USA. Und hat der Klimapolitik weltweit den Kampf angesagt. Der US-Präsident ist nicht der einzige, auch in Europa üben Rechte Druck aus. Wie groß kann der Backlash in der Klimapolitik werden? Wie steht es um das Bild von der EU und Deutschland als Vorreiter beim Klimaschutz? Welche Signale sendet die schwarz-rote Bundesregierung?
Darüber spricht Martina Mescher aus dem Politik-Team der wochentaz mit Susanne Schwarz, Co-Leiterin des taz-Ressorts Wirtschaft und Umwelt, Anja Krüger, taz-Parlamentskorrespondentin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Klimapolitik und taz-Klimaredakteur Jonas Waack.
Diese Folge wurde aufgezeichnet am 12. November 2025 um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Zohran Mamdani ist der jüngste und der erste muslimische Bürgermeister von New York City. Und auch noch demokratischer Sozialist. Ist er nur ein politisches one hit wonder? Oder leuchtet Mamdani den US-Demokraten den Weg, wie man Trump besiegen kann? Der 34 jährige hat mit einem klassisch sozialdemokratischen Programm - Mietpreisbremse, kostenlose Kinderbetreuung und besserem Nahverkehr – gewonnen. Und mit viel Charisma. Und mit lässiger Tik-Tok Präsenz. Doch die Widerstände werden enorm sein. Trump will ihm den Geldhahn zudrehen. Und die Wall Street findet „Tax the rich“ auch nicht lustig.
Die SPD regiert seit 25 Jahren fast ununterbrochen. Aber viele haben den Eindruck, dass man immer weniger weiß, warum sie das tut. Dei Partei wirkt vom Bürgergeld bis zur Wehrpflicht zerrissen. Eine linke Basis-Initiative will nun das Ende des Bürgergeld im letzten Moment kippen, ohne viel Aussicht auf Erfolg. Denn die SPD ist zum Regieren verdammt - jenseits von Schwarz Rot wartet die AfD. Doch die Sozialdemokratie tut sich schwer, gegen die aggressive Merz-Union ein eigenes Profil zu entwickeln.
Die AfD hat in Umfragen mit der Union gleichgezogen und in der CDU wird man nervös. Kanzler Merz will die extrem rechte Partei nun offensiver bekämpfen und erteilt allen Annäherungsversuchen eine klare Absage. Gleichzeitig macht er eine Debatte auf voller Suggestion und Ressentiments, die Wasser auf die Mühlen der AfD sein dürfte. Was soll diese Debatte über das Stadtbild? Warum sollen wir unsere Töchter fragen?
Über einen Kanzler zwischen Hilflosigkeit, Trotz und Rassismus geht es in dieser Folge des Bundestalks. Es diskutieren Gender-Redakteurin Patricia Hecht, Jasmin Kalarickal, die in der taz für Sozialpolitik zuständig ist, und Seite 1-Redakteur Lukas Wallraff. Sabine am Orde, innenpolitische Korrespondentin, moderiert.
Bei der taz steht ein großer Einschnitt an: Nach 46 Jahren erscheint die Zeitung werktags nicht mehr auf Papier. Ein guter Moment, um über uns selbst zu sprechen und über den Journalismus der Zukunft.
Was ändert sich jetzt für die taz? Wie lässt sich Online-Journalismus finanzieren? Was passiert, wenn auf Social Media Journalismus, Influencer-Content und Werbung ineinanderfließen? Und wäre eine KI-freie taz überhaupt denkbar?
Darüber spricht [Sabine am Orde](https://taz.de/Sabine-am-Orde/!a29/), innenpolitische Korrespondentin der taz, mit Chefredaktuerin [Ulrike Winkelmann](https://taz.de/Ulrike-Winkelmann/!a41/), [Anne Fromm](https://taz.de/Anne-Fromm/!a243/), die das Recherche-Ressort leitet und im Vorstand der taz-Genossenschaft sitzt, und Medienredakteurin [Ann-Kathrin Leclerc](https://taz.de/Ann-Kathrin-Leclere/!a108114/) - über Haltung, Geld und die Zukunft und was Journalismus bei der taz heute braucht.
Die Waffen in Gaza schweigen. Jubel in Gaza und Israel. Doch dies kann nur der erste Schritt sein. Viel ist in Trumps 20-Punkte-Plan unklar. Ein palästinensischer Staat wird nur vage angedeutet. Die Gewalt der Siedler in der Westbank und die Besatzung fehlen in dem Plan. Ob die Hamas ihrer Entwaffnung wirklich zustimmt ist ebenso offen wie die Frage, ob Israel sich vollständig aus Gaza zurückzieht. Ein weiteres Problem: Die Hamas soll sich laut faktisch auflösen. Netanjahu droht, wenn der Krieg endet, der Gang in das Gefängnis wegen Korruption. Keine idealen Anreizsysteme für Frieden. Und trotzdem: So viel Hoffnung auf ein Ende der Gewalt in Nahost gab es seit dem 7. Oktober 2023 nicht mehr.
Seit zwei Wochen zeigen sich die europäische Medienöffentlichkeit und die Gremien von EU und Nato aufgeregt besorgt. Erst dringen russische Kampfjets in den estnischen Luftraum ein, dann überfliegen Drohnen sensible Bereiche in Dänemark, Norwegen, Polen und Deutschland. Sicherheitsexperten sind sich ziemlich einig, dass all diese Aktionen von Russland ausgehen, das Europa und die Nato "testen" wolle.
Seither tobt die Debatte darüber, wie es um die Verteidigungsfähigkeit des Westens auch gegen solche Übergriffe bestellt ist. In Deutschland etwa ist nicht einmal wirklich klar, wer eigentlich für den Abschuss solcher Drohnen zuständig wäre und mit welchem Gerät das erfolgen könnte, sollte man sich dafür entscheiden.
Aber auch die Frage, wie jetzt reagiert werden sollte, ist umstritten: Gelassen, entschieden, militärisch? Eine Eskalation will niemand, aber was wirkt denn eher deeskalierend - Entschlossenheit oder vorsichtiges Abwägen?
Auch die Frage, welche Botschaft der russische Machthaber eigentlich senden will, ist umstritten. Schließlich formuliert dieser ja schon seit einigen Jahren, der Westen befinde sich im Krieg gegen Russland. Ist es die direkte Vorbereitung eines militärischen Angriffs auf die kleinen baltischen Staaten der Nato-Ostflanke, geht es schlicht um das Stiften von Aufregung und Unruhe, um das Sammeln von Informationen - oder alles zusammen?
Darüber spricht taz-Auslandsredakteur Bernd Pickert in dieser Folge mit Auslandsressortleiterin und Osteuropa-Expertin Barbara Oertel, Wochentaz-Politikchefin Tanja Tricarico und dem freien Osteuropa-Autor Mathias Brüggmann.
Kein Thema überwölbt die Generaldebatte der Vereinten Nationen diese Woche in New York so sehr wie der anhaltende Krieg im Nahen Osten und die Katastrophe in Gaza. Noch vor Beginn der Generalversammlung mit den Reden der Staats- und Regierungschefs traf sich die sogenannte Zwei-Staaten-Konferenz, die vor einigen Monaten auf Initiative Frankreichs und Saudi-Arabiens ins Leben gerufen worden war. Sie bekräftigten die New Yorker Erklärung, die im Juli verabschiedet worden war und Wege hin zu Waffenstillstand, Kriegsende und einem palästinensischen Staat aufzeigt. Gleichzeitig erklärten einige europäische Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien und Portugal, nunmehr Palästina als Staat offiziell anzuerkennen. Die israelische Regierung lehnt sowohl das eine wie das andere kategorisch ab.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist nicht zur UN-Generalversammlung gereist. Die Bundesregierung ist nur durch Außenminister Johann Wadephul (auch CDU) vertreten - der darf aber erst am Samstag vor der Generalversammlung sprechen, wenn alle hochrangigen Teilnehmer längst wieder abgereist sind.
Birgt die neue Zwei-Staaten-Initiative tatsächlich Chancen? Was bedeutet die offizielle Anerkennung eines palästinensischen Staates konkret? Wie und von wem könnte ein palästinensischer Staat eigentlich regiert werden? Und wie reagiert die israelische Öffentlichkeit auf den wachsenden Druck von außen? Und warum eigentlich fährt ausgerechnet der "Außen-Kanzler" Friedrich Merz nicht nach New York?
Darüber spricht taz-Auslandsredakteur Bernd Pickert mit Israel-Korrespondenten Felix Wellisch, Nahost-Redakteurin Lisa Schneider und Stefan Reinecke aus dem taz-Parlamentsbüro.
Die SPD hat bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen mit 22,1 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt. Parteichefin Bärbel Bas, selbst Duisburgerin, meint, zumindest sei das Desaster ausgeblieben. Das Desaster wäre dann wohl ein noch besseres Abschneiden der AfD und ein weiterer Absturz der SPD gewesen. Doch die AfD hat ihr Ergebnis verdreifacht. In zwei Ruhrgebietsstädten, Gelsenkirchen und Duisburg, hat sie es sogar in die Stichwahl für den Oberbürgermeister-Posten geschafft.
Die AfD wird in NRW landesweit mit 552 statt 186 Vertretern in den Kommunalparlamenten weiter spalten und hetzen. Sie haben von der schlechten politischen Stimmung, Abstiegsängsten, rassistischen Debatten und verfallenden Stadtteilen profitiert. Dabei hetzt die AfD Arme gegen noch Ärmere auf.
Ist die rechtsextreme Partei jetzt endgültig auch im Westen angekommen? Ist sie die neue Arbeiterpartei? Und: Wie kann die SPD eigentlich noch erfolgreich sein? Darüber sprechen wir, das Ruhrgebiet fest im Blick, in der neuen Folge des Bundestalks. Es geht um Strukturwandel und Abstiegsängste, Schrottimmobilien und Armutsmigration. Außerdem schauen wir uns den Sozialdemokraten Marc Herter genauer an. Er ist in Hamm mit beachtlichen 63,6 Prozent der Stimmen als Oberbürgermeister bestätigt worden. Herter hat es geschafft, den Negativtrend in seiner Kommune umzudrehen. Kann er Vorbild sein?
Das diskutiert Sabine am Orde, innenpolitische Korrespondentin der taz, mit dem NRW-Korrespondenten Andreas Wyputta, Anna Lehmann, SPD-Kennerin und Leiterin des Parlamentsbüros, die im Wahlkampf in Gelsenkirchen unterwegs war, sowie AfD-Watcher Gareth Joswig.
Es scheint offenkundig: Macht- und Einflusszonen auf der Welt teilen sich gerade neu auf, mit ungewissem Ausgang. Und dabei sind es eben nicht nur die großen Akteure wie China, die USA oder Russland, die eine Rolle spielen. In den vergangenen Jahren hat der Globale Süden einiges unternommen, um auf der Bühne internationaler Politik sichtbarer zu werden.
Ob es das Abstimmungsverhalten vieler Länder bei den UN-Abstimmungen über den Ukrainekrieg war, G20-Konferenzen oder die Sicht auf den Gaza-Konflikt - die "westliche" Weltsicht steht längst nicht mehr als tonangebend dar. Wie unterscheiden sich die Debatten in Afrika, Asien und Lateinamerika vom deutschen und innereuropäischen Diskurs? Welche Themen beschäftigen Menschen und Medien im Globalen Süden, von denen wir hier gar nichts mitbekommen? Welches Ansehen, welche Glaubwürdigkeit haben vom Westen hochgehaltene Werte wie der einer "regelbasierten Weltordnung"? Und wurde die Wiederwahl Donald Trumps in den USA eigentlich im Globalen Süden ebenso verschreckt wahrgenommen wie in Europa?
In diesen Tagen treffen sich die außereuropäischen Auslandskorrespondent*innen der taz in Berlin mit der Redaktion. Das haben wir ausgenutzt. Deshalb diskutiert in dieser Folge Auslandsredakteur Bernd Pickert mit den Korrespondentinnen Helena Kreiensiek (Senegal), Natalie Mayroth (Indien) und Katharina Wojczenko (Kolumbien).
Vergangene Woche verkündete Robert Habeck im taz-Interview sein Ausscheiden aus dem Bundestag. „Ich will eine neue Geschichte“, erklärte der ehemalige Wirtschaftsminister. Habeck hatte die Ankündigung seines Rückzugs mit scharfer Kritik an Politikern der Union verbunden. Über Söder sagte der Grünen-Politiker: „Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik.“ Auch die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wurde von Habeck attackiert. Friedrich Merz nannte diese Art des Abschieds aus der Politik peinlich.
Habeck war eine Schlüsselfigur der Grünen und deren Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl. Die Niederlage der Grünen bei der Wahl geht allerdings größtenteils auf seine Kappe zurück: Die Partei konnte nur 11,6 Prozent der Wähler überzeugen.
Ist sein Ausstieg ein Zeichen eines Umbruchs? Denn zusammen mit Annalena Baerbock und Winfried Kretschmann verlassen zentrale Akteure des Mitte-Kurses der Grünen die Bühne. Das Szenario weckt Erinnerungen an den Abtritt vom ehemaligen Außenminister Joschka Fischer 2005. Damals brauchten die Grünen eine Weile, um sich neu zu sortieren. Diesmal scheint ihnen der Umbruch besser zu gelingen. Auch wenn unklar ist, wer Habeck beerben wird.
Darüber spricht Stefan Reinecke mit Chefredakteurin Ulrike Winkelmann, Parlamentskorrespondent Tobias Schulze und Reporter Peter Unfried.
Kanzler Friedrich Merz behauptet, dass unser Sozialstaat "nicht mehr finanzierbar" ist. Die SPD kontert, dass es mit ihr keine Kürzungen geben wird. Das macht das ohnehin verspannte Klima in der Koalition nicht besser. Sind das zwei Züge, die aufeinander zu rasen? Erst mal nicht. Denn jetzt sollen Kommissionen zu Pflege, Gesundheit und Rente Vorschläge machen. Das wird dauern.
Nur beim Bürgergeld ist sich Schwarz-Rot weitgehend einig: Für Arbeitslose werden sich die Bedingungen verschärfen. Nötig wäre auf jeden Fall eine andere Erzählung über den deutschen Sozialstaat - nämlich nicht als teurer Sanierungsfall, sondern als leistungsfähiges soziales Netz, um das viele Deutschland beneiden.
Darüber und mehr spricht Stefan Reinecke mit Barbara Dribbusch, Redakteurin für Soziales, Manuela Heim, Redakteurin für Gesundheit und soziale (Un-) Gerechtigkeit und Anna Lehmann, Leiterin des taz-Parlamentsbüros.
Es waren Tage voller überaus sichtbarer Diplomatie: Am Freitag vergangener Woche hofierte US-Präsident Donald Trump Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Alaska. Am Montag empfing Trump dann der Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj in Washington, in Begleitung von fünf europäischen Regierungschefs, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Chef Mark Rutte. Ganz offensichtlich war die Sorge groß, Trump könnte Selenskyj erneut demütigen wie beim letzten Besuch im Weißen Haus Ende Februar. Immerhin, das ist nicht passiert, nachdem alle Besucher Trump umschmeichelten.
Vor, während und nach all diesen Treffen gingen die russischen Angriffe auf die Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Gleichzeitig behauptet US-Präsident Trump, ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj stehe auf sein Drängen hin unmittelbar bevor, und schon bieten sich die Schweiz und Ungarn als mögliche Austragungsorte an, obwohl aus dem Kreml eher kühle Zurückhaltung gegenüber dieser Idee signalisiert wird.
Dennoch läuft jetzt eine Diskussion über Szenarien zur Beendigung des Krieges, über Gebietsabtretungen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Dabei ist zunächst nicht einmal ein Waffenstillstand in Sicht: Der wird zwar von der Ukraine und den Europäern gefordert, von Russland aber abgelehnt und von Trump nicht unterstützt.
Ist diese ungewöhnliche Gipfeldiplomatie dennoch ein Fortschritt? Bringt sie die Ukraine näher an ein Ende des seit dreieinhalb Jahren andauernden Krieges? Welche Rolle spielt die europäische "Koalition der Willigen", als deren Anführer sich der französische Präsident Emmanuel Macron, der Brite Keir Starmer und Bundeskanzler Friedrich Merz inszenieren? Können sie der Ukraine das Vertrauen geben, was sie in die Trump-Regierung kaum haben kann? Und was ist von der Diskussion um mögliche europäische Truppenentsendungen zur Absicherung eines zukünftigen Friedens zu halten?
Darüber spricht in dieser Folge taz-Auslandsredakteur Bernd Pickert mit Auslandsressortleiterin und Osteuropa-Expertin Barbara Oertel, Brüssel-Korrespondenten Eric Bonse und Parlamentskorreskondent Stefan Reinecke.
"Es gab ein vorher und ein nachher", so hat es Angela Merkel in ihren Memoiren beschrieben - und mein die Nacht von 4. auf den 5. September 2015 damit. Damals machten sich die Geflüchteten, die am Bahnhof in Budapest gestrandet waren, auf den Weg nach Österreich und vor allem nach Deutschland. Und die Bundesregierung stand vor der Entscheidung, was sie tut, wenn die Menschen zu Tausenden an der deutschen Grenze ankommen.
Wo stehen wir zehn Jahre nach Merkels Entscheidung, die Grenzen nicht zu schließen - nicht nur in der Asyl- und Migrationspolitik, auch mit Blick auf Union und AfD, auf die Polarisierung der Gesellschaft und den Zustand der Demokratie? Darüber sprechen wir in der neuen Folge des Bundestalks.
Mit dabei sind Frederik Eickmanns, Redakteur für Migration im Inland der taz, Ressortleiterin Dinah Riese und Christian Jakob aus dem Reportage und Recherche-Ressort. Moderiert wird die Folge von Sabine am Orde, innenpolitische Korrespondentin der taz.





Ganz konkret: Welche Änderungen ausgehend vom GEG2020 hat Herr Habeck vorgenommen, die "handwerklich schlecht" waren? Was war vorher daran besser!? Sie haben die Schmutzkampagne gegen die Grünen 1:1 unreflektiert einfach übernommen. Die Grünen haben das Gesetz der Union ENTSCHÄRFT und sozialverträglich gemacht.