Discover Das Politikteil
Das Politikteil

Das Politikteil
Author: DIE ZEIT
Subscribed: 16,643Played: 617,127Subscribe
Share
© ZEIT ONLINE
Description
Kann die Zeitenwende gelingen? Wie weit geht der Aufstieg der Populisten? Und welche Macht gewinnt KI über unser Leben?
Am Ende der Woche sprechen wir über Politik – was sie antreibt, was sie anrichtet, was sie erreichen kann. Jeden Freitag zwei Moderatoren, ein Gast und ein Geräusch.
Im Wechsel hören Sie hier Ileana Grabitz, Peter Dausend, Tina Hildebrandt, und Heinrich Wefing.
Mehr hören? Dann testen Sie jetzt unser Podcast-Abo 4 Wochen gratis unter www.zeit.de/podcastabo
Auch in der ZEIT und auf zeit.de berichten wir ausführlich über das politische Geschehen. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen unter www.zeit.de/politikteil-abo
Am Ende der Woche sprechen wir über Politik – was sie antreibt, was sie anrichtet, was sie erreichen kann. Jeden Freitag zwei Moderatoren, ein Gast und ein Geräusch.
Im Wechsel hören Sie hier Ileana Grabitz, Peter Dausend, Tina Hildebrandt, und Heinrich Wefing.
Mehr hören? Dann testen Sie jetzt unser Podcast-Abo 4 Wochen gratis unter www.zeit.de/podcastabo
Auch in der ZEIT und auf zeit.de berichten wir ausführlich über das politische Geschehen. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen unter www.zeit.de/politikteil-abo
277 Episodes
Reverse
Gut zwei Dutzend AfD-Politiker sind in dieser Woche in die USA gereist,
um ihr Netzwerk mit den Republikanern auszubauen. Ihr Besuch fällt
zeitlich zusammen mit der Verkündung einer neuen Sicherheitsstrategie
durch Präsident Donald Trump, die rechtspopulistische Kräfte als die
Hoffnung in einem kulturell und zivilisatorisch verrotteten liberalen
Europa feiert. Für die CDU, der traditionelle Lordsiegelbewahrer der
Westbindung Deutschland, ist die immer engere Anbindung der AfD an die
Machthaber in Washington, D. C. ein Schock – und zugleich ein
Warnsignal: Die bereits 2017 von der AfD verkündete "Jagd" auf die CDU
tritt in eine neue Phase. Sie trifft die Christdemokraten zu einem
Zeitpunkt, da ihr Kanzler auf eine sehr gemischte Bilanz seiner
bisherigen Amtszeit zurückblicken muss.
In der neuen Ausgabe von "Das Politikteil" sprechen Ileana Grabitz und
Peter Dausend mit Mariam Lau über die Folgen dieser Wachablösung als
Lieblingspartner der US-Regierung – für das Selbstverständnis der CDU,
aber auch für das Selbstbewusstsein und das Machtstreben der AfD. Die
langjährige Parlamentskorrespondentin der ZEIT beschreibt die
Jubelstimmung bei den Rechten und den Frust der Konservativen. In der
neuen US-Sicherheitsstrategie sieht Lau, ähnlich wie der CDU-Politiker
Norbert Röttgen, eine "zweite Zeitenwende" (nach dem Überfall Russlands
auf die Ukraine), die eine völlige Neuordnung der globalen
Machtverhältnisse zur Folge haben könnte. Sie lobt den Bundeskanzler
dafür, dass er das Machtvakuum, das Trump mit seiner Kehrtwende erzeugt
hat, gemeinsam mit anderen europäischen Regierungschefs zu füllen
versucht – und kritisiert ihn für seine innenpolitische Bilanz.
Lau, Autorin eines Merz-Buches, sieht den Kanzler in seinem
Regierungshandeln prinzipiell "viel unideologischer, als viele vorher
gedacht haben" und beobachtet bei dem 70-jährigen "Anti-Scholz" eine
überraschende Entwicklung: "Er lernt – und das Lernen macht ihm Spaß."
Optimistischer als viele andere blickt Lau voraus auf das Superwahljahr
2026 mit insgesamt fünf Landtagswahlen. Die erwarteten Erfolge für die
AfD könnten noch verhindert werden, wenn sich die schwarz-rote
Regierungskoalition an eine ebenso simple wie wirkmächtige Formel
hielte: "Einfach mal machen."
Mariam Lau ist in Teheran geboren, ihr Vater ist der Publizist und Autor
Bahman Nirumand. Ihr Werdegang ist ungewöhnlich: Nach einer Ausbildung
zur Krankenpflegerin studierte sie Kunstgeschichte, Filmwissenschaft und
Amerikanistik. Ihre journalistische Karriere führte sie zu solch
unterschiedlichen Blättern wie der "taz" und der "Welt". Seit 2010
arbeitet sie als politische Korrespondentin für DIE ZEIT in Berlin.
Ein Aufruf für unseren Weihnachtspodcast: Weil wir auch ein interaktiver
Podcast sind, beantworten wir in unserer Weihnachtsfolge wieder ein paar
Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Fragen Sie uns, was Sie schon immer
wissen wollten, aber sich nie zu fragen getraut haben. Gerne kurz und
knapp an die bekannte Adresse daspolitikteil@zeit.de. Oder als
Sprachnachricht per WhatsApp an +494074305513.
Igor Levit in "Das Politikteil": Am 27. Januar gehen Tina und Heinrich
in die Oper und sprechen in der Berliner Staatsoper Unter den Linden
live mit dem weltberühmten Pianisten Igor Levit über den schwierigen
Begriff Heimat: Was heißt es, dazuzugehören? Wo fühlt Levit sich zu
Hause?
Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was
Politik beschäftigt, erklären die Hintergründe, diskutieren die
Zusammenhänge. Immer freitags mit zwei Moderatoren, einem Gast – und
einem Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Tina Hildebrandt und
Heinrich Wefing oder Ileana Grabitz und Peter Dausend zu hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Mit allem zeremoniellen Pomp hat der britische König Charles III.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in London empfangen, inklusive
Kutschen, Käse und Gala-Diner. Warum eigentlich? Was bringt eine solche
Visite – außer schönen Bildern? Ist ein König überhaupt noch zeitgemäß?
Oder hilft er womöglich mehr im Kampf gegen den Populismus als ein
gewähltes Staatsoberhaupt?
Darüber sprechen wir diese Woche in Das Politikteil, dem politischen
Podcast der ZEIT, mit einem Mann, der sogar schon einmal der Queen die
Hand geschüttelt hat: Zu Gast bei Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing
ist Patrik Schwarz, geschäftsführender Redakteur der ZEIT, als
gebürtiger Bayer Freund des Barocken und alles Überflüssigen und in
dieser Eigenschaft der geborene royale Reporter der ZEIT. Er begleitet
den Staatsbesuch des Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich.
Patrik Schwarz erzählt, welche Gastgeschenke Steinmeier dabeihat, zum
Beispiel Biokäse aus Brandenburg: „Cheese is coming home.“ Und er
erklärt, dass ein solcher Staatsbesuch kein Familienausflug ist, sondern
eine hochpolitische Angelegenheit. Der König empfängt nicht zu seinem
Privatvergnügen, sondern im Auftrag des Premierministers. Hinter der
Einladung Steinmeiers steckt eine klare strategische Absicht. King
Charles III., sagt Patrik Schwarz, ist eine "Geheimwaffe", das
Vereinigte Königreich mache "mit seinen working royals Politik".
Dass die Monarchie in der Krise ist, wegen Prince Harry und mehr noch
wegen der mutmaßlichen Verwicklung von Prince Andrew in den
Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein, ändert offenbar nichts daran,
dass sie nützlich ist: "Die Monarchie ist in der Krise – was soll’s?
Heinrich der Achte war auch kein netter Kerl", sagt Patrik Schwarz.
Wir sprechen außerdem über die Lage Großbritanniens gut fünf Jahre nach
dem Brexit, dem Austritt aus der EU. Patrik Schwarz sagt: "Inzwischen
fühlen sich viele Briten mit dem Brexit so, wie wenn man zu lange im Pub
gewesen ist." Aber er erklärt auch, warum einer der Anführer der
Brexit-Bewegung, Nigel Farage, dennoch in den Umfragen immer stärker
wird und womöglich sogar der nächste Premierminister werden könnte.
Im Podcast Das Politikteil sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik beschäftigt, erklären die Hintergründe, diskutieren die
Zusammenhänge. Immer freitags, mit zwei Moderatoren, einem Gast – und
einem Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Tina Hildebrandt und
Heinrich Wefing oder Ileana Grabitz und Peter Dausend zu hören.
Weihnachtspodcast: Weil wir auch ein interaktiver Podcast sind,
beantworten wir in unserer Weihnachtsfolge wieder ein paar Fragen
unserer Hörerinnen und Hörer. Fragen Sie uns, was Sie schon immer wissen
wollten, aber sich nie zu fragen getraut haben. Gerne kurz und knapp an
die bekannte Adresse daspolitikteil@zeit.de. Oder als Sprachnachricht
per WhatsApp (Telefonnummer: +494074305513)
Igor Levit in Das Politikteil: Am 27. Januar gehen Tina und Heinrich in
die Oper und sprechen in der Berliner Staatsoper Unter den Linden live
mit dem weltberühmten Pianisten Igor Levit über den schwierigen Begriff
Heimat: Was heißt es dazuzugehören? Wo fühlt Levit sich zu Hause?
Karten sind im Verkauf der Berliner Staatsoper und unter diesem Link
erhältlich:www.staatsoper-berlin.de/das-politikteil-live.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Der Neue Roundtable ist da! In unserer monatlichen Bonus-Folge sprechen
wir dieses Mal über Friedrich Merz' Schwierigkeiten, seine eigene
Parteijugend zu erreichen, berichten von der Gründungsveranstaltung der
"Generation Deutschland" und erklären, warum die Grünen ein Problem
haben: Sie können nicht linksradikal werden.
Die komplette Folge können Sie mit einem Podcat-Abo der ZEIT hören. Ein
kostenloses Probeabo können Sie auf Apple Podcasts abschließen, auf
Spotify oder unter www.zeit.de/podcastabo.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Sehnsucht nach starker Führung, Russlandnähe, die Überzeugung, die DDR
sei der moralisch überlegene Staat gewesen: Dreieinhalb Jahrzehnte nach
dem Fall der Mauer wirken die mentalen Muster der längst untergegangenen
Deutschen Demokratischen Republik immer noch nach. In Verbindung mit
enttäuschten Erwartungen, Verlusterfahrungen und dem weitverbreiteten
Gefühl der moralischen Ausgrenzung bilden sie den Hintergrund des
scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs der AfD in Ostdeutschland. Zwar sind
die Rechtspopulisten auch im Westen auf dem Vormarsch, doch in
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnten sie nach den Wahlen im
kommenden Jahr sogar regieren – und ihre antidemokratische Agenda
durchsetzen. Wie kann man sie stoppen?
In der neuen Ausgabe von "Das Politikteil" sprechen Ileana Grabitz und
Peter Dausend vor Live-Publikum in der Berliner Staatsoper Unter den
Linden mit der Schriftstellerin Anne Rabe über die Gefährdung der
Demokratie durch den Siegeszug des Rechtspopulismus. Aufgewachsen in den
90er Jahren, zwischen demokratischem Aufbruch und den mentalen
Restbeständen der DDR, analysiert Rabe, wie der Mix aus Diktaturprägung,
frustrierten Hoffnungen und den Gewalterfahrungen der
"Baseballschläger-Jahre" die politische Haltung vieler Menschen im Osten
bis heute prägt. Rabe beschreibt die Fehleinschätzung der Politik, dass
sich nach dem Mauerfall eine funktionierende Zivilgesellschaft aus sich
selbst heraus entwickeln würde. Sie kritisiert den anhaltenden Versuch
der Union, die AfD dadurch bezwingen zu wollen, indem sie deren Wortwahl
und deren Forderungen – zumindest teilweise – übernimmt. Heftig
widerspricht sie der Überlegung, die AfD durch Einbindung in
Regierungsverantwortung entzaubern zu wollen. Und sie zeigt auf, wie die
zunehmende Verachtung der Moral die AfD stärkt.
Anne Rabe ist eine deutsche Dramatikerin, Lyrikerin, Drehbuchautorin und
Essayistin. 1986 in Wismar geboren, studierte sie von 2005 an zunächst
Germanistik an der FU Berlin. Von April 2006 bis Februar 2010 studierte
sie Szenisches Schreiben an der Fakultät Darstellende Kunst der
Universität der Künste Berlin. Sie veröffentlichte zu dieser Zeit erste
Gedichte und Theaterstücke. Einem größeren Publikum wurde sie mit ihrem
2023 erschienenen, autobiografisch geprägtem Romandebüt "Die Möglichkeit
von Glück" bekannt, das auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises
sowie des "aspekte"-Literaturpreises stand. 2025 veröffentlichte sie das
Essaybuch "Das M-Wort. Gegen die Verachtung der Moral".
Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik beschäftigt, erklären die Hintergründe, diskutieren die
Zusammenhänge. Immer freitags mit zwei Moderatoren, einem Gast – und
einem Geräusch. Neben Ileana Grabitz und Peter Dausend sind auch Tina
Hildebrandt und Heinrich Wefing als Gastgeber zu hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
"Das Politikteil" wächst: Ab sofort erscheint jeden Monat eine
zusätzliche Sonderfolge von "Das Politikteil". Im Format "Der
Roundtable" analysieren Ileana Grabitz, Tina Hildebrandt, Heinrich
Wefing und Peter Dausend die aktuelle Nachrichtenlage – für Sie und ein
bisschen auch für sich selbst.
Zu hören sind diese zusätzlichen Folgen unter
www.zeit.de/daspolitikteil, auf Apple Podcasts und auf Spotify, exklusiv
mit einem Podcast- oder Digitalabo der ZEIT. Mit einem Abo können Sie
außerdem das komplette Archiv von "Das Politikteil" hören, erhalten
monatlich Bonusfolgen von "ZEIT Verbrechen" und "OK, America?" sowie
Zugriff auf unsere Dokupodcasts wie "Irma. Das Kind aus Srebrenica" oder
"Friedrich Merz: Sein langer Weg zur Macht".
Ein kostenloses digitales Probeabo der ZEIT können Sie hier abschließen.
Das Podcast-Abo kostet nur 4,99 Euro im Monat und kann hier gratis
getestet werden.
Wer bereits ein Abo hat, kann es mit Apple Podcasts oder Spotify
verbinden. Wie das geht, können Sie hier nachlesen.
Wer kein Abo abschließt, findet auch in Zukunft wie gewohnt jeden
Freitag eine neue Folge in seinem Podcast-Feed.
Mit allen weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an kontakt@zeit.de.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Hören Sie unseren neuen Doku-Podcast "Friedrich Merz: Sein langer Weg
zur Macht" unter www.zeit.de/merz und in Ihrer Podcast-App.
Privatjets, Tabubrüche und ein großes Comeback. Friedrich Merz ist kein
Politiker wie jeder andere. Und nun wird er Deutschlands nächster
Kanzler. Aber was treibt ihn an? Und kann man ihm vertrauen?
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
In den Tagen nach der Bundestagswahl richten sich alle Augen auf
Friedrich Merz, den – höchstwahrscheinlich – nächsten Kanzler der
Bundesrepublik Deutschland. Hat er das Format, das Land in einer sich
radikal verändernden Welt aus diversen Krisen zu führen? Über den
CDU-Mann gibt es zwei Erzählungen: Die einen sehen in ihm einen
Klartext-Politiker, der mit eindeutigen Ansagen den Kurs vorgibt – und
die anderen jemanden, dessen Entschiedenheitsgestus verbirgt, dass er
viele seiner Ansagen wieder einsammeln muss. Welche stimmt?
In der neuen Ausgabe von „Das Politikteil Roundtable“ diskutieren wir
über die Kanzlertauglichkeit des Friedrich M., über einen „krass blauen“
Osten, in dem die AfD endgültig zur stärksten politischen Kraft
aufgestiegen ist, darüber, warum man das sich abzeichnende
Regierungsbündnis aus Union und SPD nicht mehr „Große Koalition“ nennen
sollte – und auch darüber, wen wir künftig wohl mehr vermissen werden:
Olaf Scholz, Robert Habeck oder Christian Lindner. Vielleicht aber auch
keinen – oder alle drei?
Am Tisch des „Roundtable“ sitzen normalerweise die vier Hosts von „Das
Politikteil“: Ileana Granitz, Tina Hildebrandt, Peter Dausend und
Heinrich Wefing. In der aktuellen Ausgabe fehlt Ileana Grabitz – Martin
Machowecz, den stellvertretenden Chefredakteur der ZEIT, stellt sich der
Herausforderung, sie ersetzen zu müssen.
Nachdem in dieser Nachwahl-Woche „Das Politikteil“ und „Das Politikteil
Roundtable“ die Plätze getauscht haben, kehren wir zum Gewohnten zurück:
Am kommenden Dienstag erscheint der neue „Roundtable“ – und am Freitag
darauf unser Klassiker „Das Politikteil“. Mit einem Gast, einem Thema –
und einem Geräusch.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Nach der Bundestagswahl scheint alles auf eine große Koalition
hinauszulaufen – und nun muss sich zeigen, wie schnell der Wahlsieger
Friedrich Merz eine tragfähige Regierung aufbauen kann. Die
Herausforderungen sind – innen- wie aussenpolitisch – gigantisch: Die
Wirtschaft steckt in einer fundamentalen Krise, die Gesellschaft ist
gespalten, zunehmend mehr Menschen das Vertrauen in die
Steuerungsfähigkeit des Staates – und unterdessen wendet sich der
ehemalige Partner USA unter der neuen Administration von Donald Trump
demonstrativ von Europa ab.
In der neuen Folge von "Das Politikteil“, die diesmal live im
ZEIT-ONLINE-Livestream zur Bundestagswahl aufgezeichnet wurde, sprechen
wir mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler über die Ergebnisse
der Bundestagswahl – und was sie für das Land bedeuten. Wie schnell wird
sich ein verlässliches Bündnis zwischen SPD und Union schmieden lassen?
Ist Friedrich Merz der Richtige für die neuen geopolitischen
Anforderungen einer Welt, in der die "regelbasierte Ordnung“ zu
zerfallen scheint? Und wie kann es der nächsten Regierung gelingen, den
Glauben der Menschen in eine bessere Zukunft zu erneuern – wenn
gleichzeitig die Wirtschaft krankt und das Geld für die notwendigen
Reformen fehlt?
Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik beschäftigt, erklären die Hintergründe, diskutieren die
Zusammenhänge. Immer freitags mit zwei Moderatoren, einem Gast – und
einem Geräusch. Neben Ileana Grabitz und Peter Dausend sind auch Tina
Hildebrandt und Heinrich Wefing als Gastgeber zu hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Wer von den Spitzenkandidaten der Parteien wird am Montag nach der Wahl
noch übrig sein? Wie stark werden die Radikalen? Und wer kann mit wem
regieren? Darüber sprechen wir wenige Tage vor der Wahl in "Das
Politikteil" mit Nikolaus Blome, langjähriger Beobachter der deutschen
Spitzenpolitik, Buchautor ("Falsche Wahrheiten, 12 linke Glaubenssätze,
die unser Land in die Irre führen“), Podcaster und Politikchef von RTL
und n-tv.
Blome zieht eine Bilanz der vielen TV-Duelle und erklärt, warum er trotz
aller Ausschließerei und harter Töne im Wahlkampf ein österreichisches
Szenario für ausgeschlossen hält, bei dem sich die Parteien der Mitte
zerlegen und so den Weg für eine Koalition mit der radikalen Rechten
weben.
Der frühere Politikchef des "Spiegel" erklärt, warum er eine starke AfD
und gleichzeitig starke Linke für gefährlich hält und warum aus seiner
Sicht eine schwarz-rot-grüne Koalition problematisch wäre. Er sagt: Die
Parteien können sich leicht darauf einigen, was die größten Probleme
sind, die angepackt werden müssen. Aber sie glauben an sehr
unterschiedliche Instrumente. Und er braucht dringend jemanden, der ihm
mit seinen Passwörtern hilft.
Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik bewegt, erklären Hintergründe und diskutieren Zusammenhänge.
Immer freitags, mit zwei Moderatoren und einem Gast – und einem
Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Ileana Grabitz und Peter Dausend
oder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing zu hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Eine Woche bevor die Deutschen entscheiden, wer sie künftig regieren
soll, hat sich der amerikanische Vizepräsident auf großer Bühne in den
Wahlkampf eingemischt: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz,
dem bedeutendsten Treffen von Außenpolitik- und Sicherheitsexperten der
Welt, warf J. D. Vance den europäischen Demokratien – insbesondere der
deutschen – vor, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken und betrieb kaum
verdeckte Wahlwerbung für die AfD. Der Vorstoß von US-Präsident Donald
Trump, mit Russlands Machthaber Wladimir Putin über einen Frieden in der
Ukraine verhandeln zu wollen und dabei die Ukrainer sowie die anderen
Europäer zu übergehen, prägte das Treffen – und sorgte für offene
Empörung. Zahlreiche europäische Regierungsvertreter kritisierten
insbesondere, dass die US-Regierung bereits vor einem ersten Treffen
mehreren russischen Forderungen entgegenkam. Zwei Fragen stellen sich
nun in größter Dringlichkeit: Schenkt Trump Putin den Sieg im
Ukrainekrieg? Und: Leben wir seit diesem Wochenende in einer Welt, in
der Amerika kein Freund mehr ist, kein Verbündeter, sondern ein Gegner?
In der neuen Ausgabe von „Das Politikteil Roundtable“ diskutieren wir
diese dramatische außenpolitische Entwicklung und gehen der Frage nach,
ob und wie sie in den verbleibenden Tagen den Wahlkampf beeinflussen
wird. Profitiert jemand von dieser transatlantischen Großkrise – oder
wird auch sie die eingemauerten Umfragewerte nicht ändern können?
Am Tisch des Roundtable sitzen normalerweise die vier Hosts von „Das
Politikteil“: Ileana Grabitz, Tina Hildebrandt, Peter Dausend und
Heinrich Wefing. Die aktuelle Ausgabe ist ein Sonderfall: Sie wurde am
Sonntagmittag auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgenommen – um den
Tisch versammelten sich neben Heinrich Wefing und Peter Dausend noch
Anna Sauerbrey, außenpolitische Koordinatorin der ZEIT, Constanze
Stelzenmüller, Inhaberin des Fritz-Stern-Chair bei der Brookings
Institution in Washington, sowie Jeff Rathke, Präsident des
American-German Institute der Johns Hopkins University, ebenfalls in
Washington.
Jeden Freitag gibt es wie gewohnt das klassische „Politikteil“ mit einem
Gast, einem Thema – und einem Geräusch.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
So schnell kann es gehen in der Politik: Die Linke war vor wenigen
Wochen noch in den Umfragen bei drei Prozent eingemauert – und erreicht
nun bis zu sechs Prozent. Meinungsforscher sagten dem Bündnis Sahra
Wagenknecht (BSW) den sicheren Einzug in den Bundestag voraus – und nun
schaut die Namensgeberin samt Anhang nervös der Wahl am 23. Februar
entgegen. Was sind die Gründe für diese überraschende Entwicklung? Warum
wirken die Totgesagten plötzlich so quicklebendig – und warum ist die
Euphorie um den Shootingstar so rasch verpufft?
In der neuen Ausgabe von „Das Politikteil“ sprechen Ileana Grabitz und
Peter Dausend mit dem Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten
Faas über den Rollentausch im linken Lager – sofern man das BSW
dazuzählen möchte. Faas analysiert den Internet-Hype um die neue
Linken-Ikone Heidi Reichinnek („Keiner kennt sie und gleichzeitig ist
sie ein Superstar“), Sinn und Unsinn der "Mission Silberlocke" („Die
alten Männer braucht es nicht“), die Auswirkung des Wechsels an der
Parteispitze und begründet, warum die Performance der Ampel ganz
wesentlich zum Aufschwung der Linken beigetragen hat.
Beim BSW beschreibt Faas, wieso das politische Faszinosum Sahra
Wagenknecht gerade an Strahlkraft verliert, welche Rolle Oskar
Lafontaine spielt, wieso das Bündnis weniger AfD-Wähler gewinnen konnte
als erwartet – und er geht der Frage nach, ob ein Scheitern an der
Fünf-Prozent-Hürde lediglich das Aus für Sahra Wagenknecht bedeuten
würde oder für das gesamte Projekt.
Professor Dr. Thorsten Faas, Jahrgang 1975, hat Politikwissenschaft an
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der London School of
Economics studiert. 2008 wurde er mit einer Arbeit über
„Arbeitslosigkeit und Wählerverhalten. Direkte und indirekte Wirkungen
auf Wahlbeteiligung und Parteipräferenzen in Ost- und Westdeutschland“
an der Uni Duisburg-Essen promoviert. Nach Lehrtätigkeiten in Mannheim
und Mainz ist er seit 2017 als Professor im Bereich Politische
Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Insitut der FU
Berlin tätig. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Wahlen,
Wahlrecht, Wahlkämpfen und Wahlstudien.
Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik beschäftigt, erklären die Hintergründe, diskutieren die
Zusammenhänge. Immer freitags mit zwei Moderatoren, einem Gast – und
einem Geräusch. Neben Ileana Grabitz und Peter Dausend sind auch Tina
Hildebrandt und Heinrich Wefing als Gastgeber zu hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Nicht mal zwei Wochen vor der Bundestagswahl sind noch immer viele
Wahlberechtigte in Deutschland unentschieden, wem sie ihre Stimme geben
sollen. Zur Wahl stehen neben den bekannten, großen Parteien auch – je
nach Bundesland mehr oder weniger – kleine Parteien, die bei Umfragen
oder Ergebnisauswertungen (sehr zu ihrem Leidwesen) gern unter dem
Sammelbegriff "Sonstige" zusammengefasst werden. Die Besonderheit in
diesem Jahr besteht darin, dass auch von den sieben namhaften Parteien
immerhin drei zittern müssen, ob sie es überhaupt wieder in den
Bundestag schaffen: die bis-gerade-noch-Regierungspartei FDP, die Linken
und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).
In der neuen Ausgabe von "Das Politikteil" diskutieren wir, ob eine
Stimme für eine kleine Partei etwas bringt oder eigentlich ein
verlorenes Votum ist. "Jede Stimme für eine kleine Partei erhöht die
Chance auf ein Dreierbündnis", sagt Paul Middelhoff. Und wir werfen
einen näheren Blick auf die FDP, auf das BSW und die Linken – und auf
die Volt-Partei: Wie gut steht es um ihre Chancen, die
Fünf-Prozent-Hürde doch noch zu knacken? Wofür stehen sie inhaltlich?
Und was würde es für künftige Koalitionsoptionen bedeuten, wenn es die
eine oder andere dieser "kleinen" Parteien in den Bundestag schafft?
Am Tisch sitzen normalerweise die vier Hosts von "Das Politikteil": Tina
Hildebrandt, Ileana Grabitz, Peter Dausend und Heinrich Wefing. In der
aktuellen Ausgabe ersetzt Paul Middelhoff Peter Dausend. Jeden Freitag
gibt es wie gewohnt das reguläre "Politikteil" mit einem Gast, einem
Thema und einem Geräusch.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Donald Trump verhängt Strafzölle, setzt auf Protektionismus, droht
anderen Ländern. Ist das schon ein Handelskrieg? Was steckt hinter
seiner Strategie, ist es überhaupt eine? Wem schadet er damit am
meisten, was bedeutet das für Europa und Deutschland? Und was könnte
eine Gegenstrategie sein?
Darüber sprechen wir in "Das Politikteil" mit Heike Buchter,
Wirtschafts- und Finanzjournalistin mit Sitz in New York und
Korrespondentin für DIE ZEIT und ZEIT ONLINE.
Heike Buchter erklärt, was man aus Trumps erster Amtszeit lernen kann
und warum wir so sehr von den USA abhängen. Sie sagt: Trump bringt auch
einen Moment der Wahrheit in die Debatte über Globalisierung und das
exportorientierte deutsche Wirtschaftsmodell. Und sie prophezeit: Die
Einführung des Nachtwächterstaats in den USA gefällt der amerikanischen
Wirtschaft mehr, als die Folgen von Zöllen sie schreckt.
Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik bewegt, erklären Hintergründe und diskutieren Zusammenhänge.
Immer freitags, mit zwei Moderatoren und einem Gast – und einem
Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Ileana Grabitz und Peter Dausend
oder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing zu hören.
Hier können Sie unseren neuen Dokupodcast, "Friedrich Merz: Sein langer
Weg zur Macht", hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Noch 19 Tage bis zur Wahl: in der vierten Ausgabe des wöchentlichen
Round Table von "Das Politikteil" besichtigen wir das innenpolitische
Trümmerfeld, das die vergangene Woche hinterlassen hat.
Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing diskutieren mit ihren Gästen Petra
Pinzler und Robert Pausch (die beiden Co-Hosts Ileana Grabitz und Peter
Dausend sind im Urlaub): War das migrationspolitische "Alles oder
nichts" von Friedrich Merz der Riesenfehler, auf den die Gegner des
CDU-Kanzlerkandidaten immer gehofft hatten? Wer profitiert davon? Und
wie kann es nach diesem Polarisierungsschub weitergehen nach der
Bundestagswahl? Wer kann dann noch mit wem koalieren – oder läuft jetzt
plötzlich alles auf eine CDU-geführte Minderheitsregierung zu?
Außerdem geht es um die Frage, warum das Klima im Wahlkampf gar keine
Rolle mehr spielt – und was die verschiedenen Parteien programmatisch
anzubieten haben.
Per E-Mail erreichen Sie uns unter daspolitikteil@zeit.de.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Was unterscheidet diesen Wahlkampf von anderen? Was bewegt Friedrich
Merz und
was seinen Kontrahenten Olaf Scholz? Was erfährt man über Alice Weidel,
wenn man
sie mehrere Monate begleitet? Und warum tun sich Politiker das
eigentlich an?
Darüber sprechen wir diese Woche in "Das Politikteil" mit Stephan Lamby,
einem
der bekanntesten Dokumentarfilmer und Chronisten der Republik, der für
seinen
neuen Film "Die Vertrauensfrage" alle politischen Protagonisten von
November bis
heute begleitet hat.
Lamby sagt: Aus Sicht der SPD hat Merz mit seiner Migrationsoffensive
endlich den
Fehler gemacht, auf den sie immer gehofft hat. Und er sagt: Merz geht es
gar nicht
mehr um ein Duell mit Scholz, sondern mit Alice Weidel, er kämpft gegen
die AfD.
Der preisgekrönte Dokumentarfilmer beschreibt, warum er Merz sein
Versprechen
abnimmt, nicht mit der AfD koalieren zu wollen und trotzdem findet,
dass die AfD
mit den Abstimmungen im Bundestag salonfähig gemacht wird. Er spricht
darüber,
wie er Politiker begleitet und warum sie ihm ungewöhnliche Einblicke
gewähren.
Und er beschreibt, wie ihn die "wachsende Sehnsucht nach Zerstörung der
bestehenden politischen Verhältnisse" an das erinnert, was in den USA
passiert.
Sein Film "Die Vertrauensfrage" wird am 10. Februar in der ARD
ausgestrahlt. Lamby hat
zudem gerade das Buch "Und dennoch sprechen wir miteinander"
veröffentlicht, in dem
er eine Reise durch die Wut zwischen Deutschland, den USA und
Argentinien
beschreibt.
Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik bewegt, erklären Hintergründe und diskutieren Zusammenhänge.
Immer freitags, mit zwei Moderatoren und einem Gast – und einem
Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Ileana Grabitz und Peter
Dausend oder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing zu hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
In den Wahlkampf kommt (endlich) Schwung: Seit Friedrich Merz als
Reaktion auf den tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg seinen
Fünf-Punkte-Plan zur Migration vorgelegt hat, tobt eine heftige Debatte
um einstürzende Brandmauern, eine frohlockende AfD, einen
CDU-Kanzlerkandidaten am Rande des Wortbruchs – und darüber, ob die
Maßnahmen überhaupt umsetzbar sind.
In der dritten Ausgabe von "Das Politikteil – Roundtable“, der
Wahlkampf-Sonderserie des Podcasts von ZEIT und ZEIT ONLINE, sprechen
wir über das Aufregerthema Migration – und wer davon profitiert, dass es
nun in den Fokus des Wahlkampfs gerückt ist. Außerdem geht es noch um
die Frage, ob die Grünen einer ähnlichen Enttäuschung am Wahltag
entgegensteuern wie 2021. Dieses Mal fehlt einer der vier Hosts – dafür
wurde aber rechtzeitig streitbarer Ersatz gefunden …
Am Tisch sitzen normalerweise die vier Hosts von "Das Politikteil“: Tina
Hildebrandt, Ileana Granitz, Peter Dausend und Heinrich Wefing. In der
aktuellen Ausgabe ersetzt Mariam Lau Heinrich Wefing. Jeden Freitag gibt
es wie gewohnt das reguläre Politikteil mit einem Gast, einem Thema und
einem Geräusch. Vom 15. Februar 2025 an sind alle Folgen von "Das
Politikteil“, die vor dem 31. März 2021 erschienen sind, nur noch
exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören – auf ZEIT ONLINE, Apple
Podcasts und Spotify. Ein kostenloses Probeabo können Sie hier
abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder Apple Podcasts verbinden
können, lesen Sie hier.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Mit dem Amtsantritt Donald Trumps sind die Ereignisse im Nahen Osten in
den Hintergrund gerückt: Die Lage in Israel bleibt nach der Freilassung
weiterer drei israelischer Geiseln angespannt. Der weltweit als
Durchbruch gefeierte Deal zwischen Israel und der Hamas belastet die
Regierung von Benjamin Netanjahu schwer: Die Kosten des Deals, allem
voran die Freilassung von im Vergleich sehr viel mehr palästinensischen
Gefangenen, scheinen den Kritikern zu hoch, ob die Waffenruhe wirklich
anhält, scheint fraglich.
In der neuen Folge von „Das Politikteil“ richten wir den Fokus bewusst
weg von den USA und in Richtung Nahost und sprechen mit Jan Ross, dem
Israel-Korrespondenten der ZEIT, über die fragile Lage im
Nahostkonflikt. Wie ist die Stimmung in Israel angesichts des
anhaltenden Geiseldramas? Wie denkt die Bevölkerung über den Deal mit
der Hamas: Sind die Kosten zu hoch oder überwiegt die Hoffnung? Wie groß
ist der Druck auf Benjamin Netanjahu? Welche Perspektiven gibt es für
eine dauerhafte Befriedung von Gaza? Und welche Rolle spielt Donald
Trump?
Jan Ross berichtet außerdem über seine Treffen mit Israelis, die auch 15
Monate nach den Anschlägen vom 7. Oktober noch immer um ihre in Gaza
gefangenen Angehörigen bangen. Die Ungewissheit über den seelischen und
körperlichen Zustand der Vermissten sei groß und "der Grad der
Information sehr unterschiedlich", sagt Jan Ross. Die jüngsten
Freilassungen hätten die gesamte israelische Gesellschaft aber wieder
sehr zusammengeschweißt.
Im Podcast Das Politikteil sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik bewegt, erklären Hintergründe und diskutieren Zusammenhänge.
Immer freitags, mit zwei Moderatoren und einem Gast – und einem
Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Ileana Grabitz und Peter Dausend
oder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing zu hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Noch 32 Tage bis zur Wahl: In der zweiten Ausgabe des wöchentlichen
Roundtable von "Das Politikteil", dem politischen Podcast von ZEIT und
ZEIT Online, sprechen die vier Hosts über den Versuch der Parteien, mit
ihren Plakaten Aufmerksamkeit für den Wahlkampf zu schaffen. Sie
diskutieren, welche Botschaften transportiert werden sollen (und welche
nicht), und fragen, warum Personalisierung in diesem Wahlkampf bislang
nicht im Zentrum steht.
Außerdem geht es um die Frage, ob die Medien die AfD erst groß gemacht
haben – oder ob es Aufgabe von Journalisten und Journalistinnen ist, den
Aufstieg der Populisten zu verhindern.
Am Tisch sitzen die vier Gastgeber von "Das Politikteil": Tina
Hildebrandt, Ileana Grabitz, Peter Dausend und Heinrich Wefing. Jeden
Freitag gibt es wie gewohnt das reguläre "Politikteil" mit einem Gast,
einem Thema und einem Geräusch. Ab dem 15. Januar 2025 sind alle Folgen
von "Das Politikteil", die vor dem 31. März 2021 erschienen sind, nur
noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören – auf ZEIT ONLINE,
auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses Probeabo können Sie
hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder Apple Podcasts
verbinden, lesen Sie hier.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
In diesen Tagen zieht Donald Trump zum zweiten Mal ein ins Weiße Haus –
diesmal zusätzlich gestärkt durch neue Allianzen mit den Chefs der
großen Techgiganten, Elon Musk und Mark Zuckerberg. Was aber bedeutet
die Verbindung von Big Tech und Big Power für die Politik in den USA?
Kann sie die Rechtspopulisten so weit stärken, dass am Ende die
Demokratie gefährdet wird? Und das nicht nur in den USA – sondern auch
in Europa und in Deutschland, wo sich vor allem Elon Musk zuletzt
lautstark einmischte in den Bundestagswahlkampf?
Darüber sprechen wir in der neuen Folge von "Das Politikteil", dem
politischen Podcast von ZEIT und ZEIT ONLINE, mit Thorsten Benner,
Mitbegründer und heutiger Direktor des Thinktanks des Global Public
Policy Institute (GPPI) in Berlin. Wir fragen: Wie konnten die großen
Social-Media-Plattformen solch eine große Macht erlangen? Und kann man
sie eindämmen – oder sind wir dafür zu spät dran?
Im Podcast "Das Politikteil" sprechen wir jede Woche über das, was die
Politik bewegt, erklären Hintergründe und diskutieren Zusammenhänge.
Immer freitags, mit zwei Moderatoren und einem Gast – und einem
Geräusch. Im Wechsel sind als Gastgeber Ileana Grabitz und Peter Dausend
oder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing zu hören.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.
Deutschland befindet sich in einem besonderen Wahlkampf: Es ist Winter,
gleich vier Kanzlerkandidaten kämpfen um die Gunst der Wähler und
Wählerinnen, und es bleibt ihnen nicht viel Zeit, gerade mal 40 Tage
sind es bis zur Wahl. Aus diesem Anlass startet „Das Politikteil“, der
politische Podcast von ZEIT und ZEIT ONLINE, einen Ableger: Bis zur
Bundestagswahl diskutieren die vier Hosts jeden Dienstag über den
Wahlkampf und das, was Deutschland bewegt – ein wöchentlicher
Roundtable.
In der ersten Ausgabe geht es um den frisch zum Kanzlerkandidaten
gekürten Noch-Kanzler Olaf Scholz und seinen trotzigen Glauben an das
Wunder von Berlin. Kann er es noch mal schaffen? Es geht um teure
Parktickets beim SPD-Parteitag. Und um den großen Erfolg der AfD – bei
gleichzeitiger Radikalisierung. Ist die Partei noch zu stoppen? Und was
erzählt ihr Erfolg über die anderen Parteien?
Am Tisch sitzen die vier Hosts von "Das Politikteil": Tina Hildebrandt,
Ileana Grabitz, Peter Dausend und Heinrich Wefing. Jeden Freitag gibt es
wie gewohnt das reguläre "Politikteil" mit einem Gast, einem Thema und
einem Geräusch.
Seit dem 15.1.2025 sind Teile des Archivs sowie Sonderfolgen von Das
Politikteil nur noch exklusiv mit einem Digitalabo der ZEIT zu hören –
auf zeit.de, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ein kostenloses
Probeabo können Sie hier abschließen. Wie Sie Ihr Abo mit Spotify oder
Apple Podcasts verbinden, lesen Sie hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr hören? Dann testen Sie unser Podcast-Abo mit Zugriff auf
alle Dokupodcasts und unser Podcast-Archiv. Jetzt 4 Wochen kostenlos
testen. Und falls Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt 4 Wochen kostenlos DIE ZEIT. Hier geht's zum Angebot.


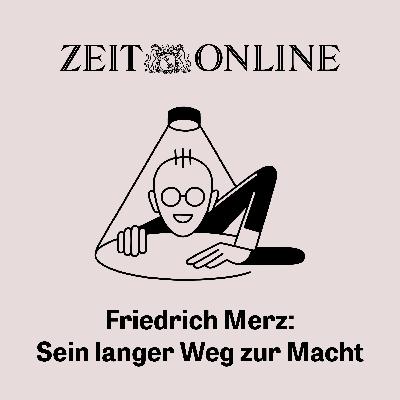



Ich habe selten eine so präzise Analyse der weltpolitischen bzw. weltwirtschaftlichen Lage gehört. A la bonne heure !
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit bedeutet: 1Mrd km/h => 24Mrd km/Tag usw.....
Das war dann leider nur vergebliche Hoffnung. Mich würde jetzt mal interessieren, wann die Zeit das kollosale Versagen und die Inkompetenz von Herrn Spahn in diesem Podcast thematisiert? Nicht nur in Bezug auf FBG, sondern auch bei der Kanzlerwahl und der Vetternwirtschaft und seiner Liebäugelei mit einer rechtsetremen Partei. Und all dem was sicher noch aufgedeckt wird von Correctiv. Die Zeit könnte so h so h da sicher gern mal anschließen.
mal so am Rande: Die Menschenwürde eines Kleinkindes ist im Flugzeug als Gepäckstück versichert. So war das nach meinem Kenntnisstand mal.
Wieso wird nicht klar gestellt, dass es eine allgemeine Überlastung der Kommunen gar nicht gibt?
Das Männer keine Kinder bekommen werden, lässt sich wohl kaum ändern. dass Männer & Frauen sich Erziehung, Haushalt Arbeiten sich aufteilen, ist aus den unterschiedlichsten Gründen längst überfällig.
Man mag es sich eigentlich nicht wünschen, dass es weiterhin so viele Anlässe für Roundtables gibt, wird es aber. Und ganz generell möchte ich die Einordnungen durch den Roundtable nicht missen. Bitte weitermachen, regelmäßig.
Inhaltsarmes Gerede.
Liebe Frau Hildebrandt, lieber Herr Wefing, Sie haben doch sonst immer so interessante Gäste bzw. Experten in Ihrer Sendung. Wieso lassen Sie sich, als Vertreter des Qualitätsjournalismus, von einem ehemaligen Redakteur der Bild-Zeitung und heutigem RTL Nachrichtenchef die deutsch Poltik erklären? Der Zungenschlag dieses Kollegen ist doch eindeutig, das haben Sie doch garnicht nötig.
hallo, hat jemand verstanden, wie das Napoleon Zitat lautet?
Spannende Themen, aber beim Thema AfD liegen (wahrscheinlich) zwei Tonspuren übereinander, da lässt sich kein Sinn aus dem Gesagten ableiten. Bitte noch einmal hochladen!
Es ist immer wieder super Florian Gasser zuzuhören. Sympathisch und authentisch.
braucht man für Wohlstand unbedingt Wachstum, oder kann man den Wohlstand halten ohne Wachstum? Und wenn ja, wäre das schlimm?
Der KI Podcast
deepfakes erkennbar? Das ist völlig Realitätsfremd. Gibt es gute Podcasts zu dem Thema
Vielen Dank für diesen informativen Podcast! Danke, dass ihr keine Schwazmaler seid!
Zur Urheberschaft der auf dem Krankenhausgelände explodierten Rakete: was ist mit dem angeblich angehörten Funkdialog der Hamas, wonach es hier um eine versehentlich dorthin geleitete Rakete handelt: konnte das verifiziert werden?
Das Wort "Vergeltungsanschlag" in dem Kontext ist nicht korrekt, gemeint ist wohl "Vergeltungsangriff" oder "Vergeltungsschlag"...
Die Aussagen der Interview Partnerin fand ich teils sehr schwer nachvollziehbar... Den Podcast an sich weiß ich jedoch sehr zu schätzen!
Man hätte den Podcast auch gerne etwas länger machen können, ich glaube bei dem Thema ist immer noch so viel zu erzählen.