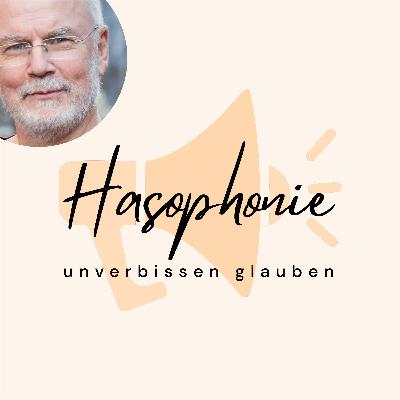Discover Hasophonie
Hasophonie

40 Episodes
Reverse
In meinem Exkurs über Allversöhnung beschäftigt mich die Erzählung vom Weltgericht in Matthäus 25 etwas länger. Diesmal geht es um die Frage: „Muss diese Erzählung als reale Beschreibung eines Weltgerichts mit doppeltem Ausgang verstanden werden? Kann man die Menschheit wirklich in Barmherzige und Unbarmherzige aufteilen? Handeln wir nicht manchmal barmherzig und manchmal nicht? Ist hier vielleicht mit Gericht etwas ganz anderes gemeint?“ Außerdem geht es darum, dass, wenn wir Matthäus folgen, das Wichtigste bei einem Menschen nicht ist, ob er rechtgläubig oder „ethisch korrekt“ ist, sondern ob er barmherzig ist. Und natürlich gilt das auch für ihn selbst: Auf den ersten Blick liest sich das Matthäus-Evangelium wie eine fortgesetzte Höllenpredigt, aber auf den zweiten ist Matthäus vor allem ein Evangelist der Barmherzigkeit.
Ich setze meinen Exkurs zum Thema Allversöhnung fort. Es geht um die Erzählung vom Weltgericht aus Matthäus 25. Eigentlich ist die Botschaft ganz einfach: Es gibt eine weitere Gruppe von Menschen, die den Leerstand der Hölle sehr vergrößert, nämlich alle, die an ihren Mitmenschen barmherzig handeln. So einfach, wie es klingt, ist es bei näherem Hinsehen allerdings nicht. Wer sich mit dem Text genauer beschäftigt, stößt auf bestimmte Fragen oder Einwände. (1) Wer sind die geringsten Brüder (und Schwestern) Jesu? Wem muss einer Gutes getan haben, um in den Himmel zu kommen? Sind tatsächlich alle Armen dieser Welt gemeint? (2) Wäre es nicht Werkgerechtigkeit, wenn jemand aufgrund seiner guten Taten in den Himmel kommt? Wer das reformatorische „Allein durch den Glauben“ verinnerlicht hat, dem macht dieser Gedanke Bauchschmerzen. (3) Muss diese Erzählung als reale Beschreibung eines Weltgerichts mit doppeltem Ausgang verstanden werden? Kann man die Menschheit wirklich in Barmherzige und Unbarmherzige aufteilen? Handeln wir nicht manchmal barmherzig und manchmal nicht? Ist hier vielleicht mit Gericht etwas ganz anderes gemeint? (4) Gibt es im Matthäusevangelium eine Gruppe von Menschen, die besonders höllengefährdet ist? In dieser Folge spreche ich über die beiden ersten dieser Fragen.
„Eine kurze Geschichte des Jenseits“ heißt die neue Folge meines Podcasts Hasophonie. Es geht noch einmal um die Erzählung von Lazarus und dem reichen Mann und besonders um die Frage: „Wo genau befinden sich die beiden? Von Himmel und Hölle ist hier ja nicht die Rede, sondern nur von Abrahams Schoß und von der Unterwelt, genauer gesagt, vom Hades.“ Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Bibel in Bezug auf das Jenseits einige Unstimmigkeiten enthält. Das löst bei manchen Zweifel aus, ob bestimmte Aussagen überhaupt ernst zu nehmen sind. Deshalb entwirre ich das, was wie ein Wirrwarr aussieht, und zeige, dass Jesus und das Neue Testament sehr stimmig mit dem umgehen, was sich an Jenseitsvorstellungen im Judentum herauskristaliisiert hatte. An Ende gehe ich dann auf die Frage ein, ob das Schicksal des reichen Mannes unwiderruflich ist oder ob es für ihn nicht doch noch einen Ausweg gibt.
Wer sich mit dem Thema Himmel und Hölle beschäftigt, kommt an der Erzählung von Lazarus und dem reichen Mann aus dem Lukasevangelium nicht vorbei. In zwei Folgen untersuche ich sie. Dabei geht es um drei Fragen:1) Warum kommt Lazarus an einen Ort der Glückseligkeit – und der reiche Mann nicht? 2) Wo genau befinden sich die beiden? Von Himmel und Hölle ist hier ja nicht die Rede, sondern nur von Abrahams Schoß und von der Unterwelt, genauer gesagt, vom Hades. 3) Ist die Gefahr, in der Leute wie der reiche Mann stehen, real oder fiktiv? Anders gefragt: Kann man aus dieser Erzählung ableiten, dass es einen Ort der Pein gibt, aus dem kein Entkommen möglich ist? Der Exklusivismus, den ich in einer früheren Folge vorgestellt habe, sagt: natürlich gibt es diesen Ort. Die Allversöhnung sagt: auf keinen Fall. Der Inklusivismus, den ich vertrete, sagt: wir werden sehen.
Kleine Kinder, wenn sie sterben, haben keinen Zutritt zur Hölle. So einfach ist das. Dennoch hat die Kirche sich in ihrer Geschichte sehr schwer damit getan, solche Kinder im Himmel zu sehen. Diese Diskrepanz führt mich zu einigen Fragen, über die ich in der neuen Folge von Hasophonie spreche: (1) Warum fiel es der Kirche so schwer? (2) Welche Indikatoren in der Bibel lassen uns darauf schließen, dass bestimmte Menschen(gruppen) Kandidaten für den Himmel sind – wenn es nicht nur die Glaubenden, aber auch nicht ausnahmslos alle sind?(3) Inwiefern treffen diese Indikatoren auf kleine Kinder zu? Außerdem erzähle ich, warum dieses Thema mich persönlich berührt.
Ich setze meine Gesprächsbeiträge zum Thema Allversöhnung fort. In der neuen Folge von Hasophonie beginnt meine Untersuchung von Einzelfällen. Hier ein kurzer Überblick, welche Gruppen von Menschen ich besprechen werde: die Glaubenden, die Kinder, die Armen, die Barmherzigen, ungläubig verstorbene Angehörige – für viele der brennendste Aspekt – und schließlich die Menschen, die bereits im Totenreich sind, und zwar in dem Teil des Hades, der als Zwischenstation zur eigentlichen Hölle dient.In dieser Folge geht es darum, dass das reformatorische „Allein durch den Glauben“ einige biblische Aussagen auf seiner Seite hat, von anderen aber in Frage gestellt wird. Wie gehen wir damit um, dass die Bibel zu vielen Themen mal hü und mal hott sagt?
In der neuen Folge von Hasophonie setze ich meine Gesprächsbeiträge zum Thema Allversöhnung fort. Ich stelle in der aktuellen Debatte ein großes Missverständnis fest. Die Sache wird so dargestellt, als ob die Alternative zur Allversöhnung eine kümmerliche Erlösung ist, bei der die Mehrheit der Menschen in der Hölle landet und der Sieg Christi in Wirklichkeit zu einer gefühlten Niederlage wird. Diese Optik ist verzerrt, sie entspricht nicht dem biblischen Gesamtzeugnis. Und sie entspricht auch nicht dem Denken vieler frühevangelikaler Höllenprediger, die eine kleine, dünnbesiedelte Hölle und einen riesigen Himmel voller Menschen erwarteten. Darüber hinaus gehe ich auf Lazarus und den reichen Mann ein und auf die Gretchenfrage, ob auch Adolf Hitler im Himmel sein wird. Und schließlich positioniere ich mich genauer als bisher und erkläre, worum es mir in diesem Exkurs geht:„Auch wenn ich diese Podcastreihe als Ferndiskussion mit Allversöhnern führe, ist mein Hauptanliegen nicht, die Allversöhnung zu widerlegen oder zu bekämpfen. Ich habe vielmehr die im Blick, die mit der Höllenlehre, die man ihnen beigebracht hat, nicht gut klarkommen, die aber wie ich nicht von der Allversöhnung überzeugt sind, weil man dann zu viel in der Bibel wegerklären müsste. Ihnen möchte ich eine Alternative zeigen. Man kann auch ohne Allversöhnung zu einer großen Hoffnung kommen. Und man ist damit biblisch auf festerem Boden und kirchengeschichtlich in guter Gesellschaft.“
Ich setze meine Gesprächsbeiträge zum Thema Allversöhnung fort und kehre zurück auf das Terrain, das ich in der ersten Folge zunächst nur sondiert habe: Folgt aus der Liebe Gottes zwingend, dass am Ende alle ohne Ausnahme in den Himmel kommen? Und wie gehen wir mit widersprüchlichen biblischen Aussagen um, die teils davon sprechen, dass die Erlösung alle Menschen einschließt, teils aber auch für einen Teil der Menschen eine ewige Strafe ankündigen? Ich habe bereits dargestellt, wie Allversöhner diese Fragen beantworten, also Christen, die glauben, dass am Ende alle in den Himmel kommen. Diese Antworten überzeugen mich und andere nicht restlos. Aber ebenso finde ich die Antworten, die ich von Vertretern der traditionellen Höllenlehre höre, unbefriedigend. Deshalb beginne ich mit der neuen Folge von Hasophonie, eine alternative Sichtweise zur Diskussion zu stellen, zunächst mit Aussagen, die ich bei Paulus im Römerbrief finde.
In dieser Folge setze ich meine Gesprächsbeiträge zur aktuellen Diskussion um die Allversöhnung fort. In der letzten Folge habe ich zunächst das Terrain sondiert, auf dem die Diskussion stattfindet, und drei Hauptargumente der Allversöhnung vorgestellt: das logische, das biblische und das historische Argument. Diesmal vergleiche ich das Fundament, auf dem die Hoffnung auf die Erlösung aller Menschen gebaut wird, mit dem, das ich bei Paulus zu finden meine. Dabei bringe ich weiterhin das Buch von Martin Thoms (»Es ist vollbracht!« Oder doch nicht?) und den Movecast 199 mit Martin Benz (Allversöhnung – dürfen wir sie glauben?) ins Gespräch mit dem Brief des Paulus an die Christen in Rom.
Es wird derzeit viel über die Allversöhnung gesprochen. Gemeint ist die Auffassung, dass am Ende alle Menschen bei Gott in seiner neuen Welt sein werden und keiner draußen, schon gar nicht an einem Ort ewiger Strafe und in einem Zustand unaufhörlicher Pein. Dass Himmel und Hölle ins Gespräch gekommen sind, liegt auch an einem neuen Buch, das gerade Furore macht: „Es ist vollbracht! Oder doch nicht?“ Martin Thoms, ein junger Theologe, hat es geschrieben und ihm den Untertitel gegeben: „Antwortversuche auf Einwände zur Fantasie der Allversöhnung.“Er steht mit seiner Meinung nicht allein. Theologische Schwergewichte wie Jürgen Moltmann und Christian Schwarz haben ein Vorwort zu seinem Buch geschrieben. Die Freunde vom Hossa Talk und Martin Benz in seinem Movecast haben den Verfasser ausführlich interviewt. Thorsten Dietz hat das Buch kürzlich auf Facebook begeistert gepriesen. So hat es eine beträchtliche Reichweite bekommen. Es liegt in der Natur der Sache, dass es unterschiedliche Reaktionen gibt. Die einen bekommen leuchtende Augen und sind erfreut, andere bekommen Bauchschmerzen und sind besorgt. Und so wie die christliche Szene funktioniert, werden wir sicher bald Podcasts hören, die die Absicht haben, das Buch zu widerlegen.Wenn ich mich in meinem Podcast an diesem Gespräch beteilige, hat das zwei Gründe. Zum einen beruft Martin Thoms sich auch auf Aussagen aus dem Römerbrief und nennt Paulus im Movecast den ersten Allversöhner. Nun geht es auf Hasophonie gerade um diesen Brief, und auch wenn ich in meiner Besprechung noch lange nicht an den entsprechenden Stellen angekommen bin, ziehe ich aus dem gegebenen Anlass diesen Exkurs vor.Der wichtigere Grund für mich ist, dass ich mich schon längere Zeit mit eigenen Gedanken zum Thema beschäftige. Ich meine, einige Fakten zur Diskussion beisteuern zu können, die kaum bekannt sind, einige Aspekte, die wenig beachtet werden und eine andere Perspektive als die sonst üblichen. In der neuen Folge von Hasophonie sondiere ich zunächst im Beobachterstatus das Terrain, auf dem die Diskussion um die Allversöhnung stattfindet, bevor ich mich dann in zwei weiteren Folgen inhaltlich positioniere.
Was ist das Evangelium? Viele verstehen es so, wie ich es kürzlich auf einer Webseite gefunden habe: „Zusammenfassung des Evangeliums in 6 Punkten: (1) Gott hat uns zu seiner Ehre geschaffen. (2) Deshalb sollte jeder Mensch zur Ehre Gottes leben. (3) Doch wir alle haben gesündigt und verfehlen Gottes Herrlichkeit. (4) Deshalb haben wir alle die ewige Strafe verdient. (5) Doch aufgrund seiner großen Barmherzigkeit sandte Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in die Welt, um Sündern den Weg zum ewigen Leben zu öffnen. (6) Deshalb ist das ewige Leben ein Geschenk für alle, die Jesus Christus als Herrn und Retter vertrauen und ihn als höchsten Schatz ihres Lebens anerkennen.“ Was immer von diesen Sätzen zu halten ist, eins sind sie nicht: Sie sind nicht das Evangelium. Sie sind nicht das, was Pauus darunter verstand und damit meinte. Nun ist es so, dass Generationen von Christen so evangelisiert haben und dieses Verständnis des Evangeliums tief verwurzelt ist. Meist geschah das in bester Absicht, und unzählige Menschen sind dadurch Christen geworden. Es gab und gibt aber auch unerwünschte Nebenwirkungen, und heute ist vielen diese Art der Evangeliumsverkündigung unangenehm. Vor allem gibt es gravierende biblische Einwände dagegen. Deshalb spreche ich in der neuen Folge von Hasophonie darüber, dass Paulus das Evangelium anders definiert hat, und zeige am Beispiel des Petrus, dass die ersten Christen so nicht evangelisiert haben.
In der neuen Folge meines Podcasts geht es zum ersten Mal um die politische Dimension des Römerbriefs. Wenn man diesen Brief vor dem Hintergrund der Verhältnisse im antiken Rom sieht, dann liest er sich wesentlich radikaler als in einer deutschen Bibelstunde. Paulus und in seinem Gefolge Markus widersprechen der herrschenden Ideologie, und ihre Texte sowie der Vergleich mit anderen neutestamentlichen Autoren zeigen, dass beide sich bewusst gegen die Anmaßungen Caesars stellen. Das Evangelium des Paulus ist nicht nur eine Heilsbotschaft zur individuellen Errettung. [Das bleibt es natürlich!] Es enthält auch eine politische Botschaft. Diese richtet sich nicht nur gegen das Imperium Romanum, sondern mit ihm gegen jede imperiale Ideologie, in der Menschen erhöht werden, die sich als Heilsbringer darstellen und ein goldenes Zeitalter versprechen.
Hat Gott einen Plan für unser Leben? Das hängt davon ab, wen du fragst. Die einen sagen: „Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben“ oder „Gott hat dich mit einem Plan erschaffen“. Andere behaupten das Gegenteil: „Gott hat nie gesagt: Ich habe einen Plan für dein Leben“ oder „Glaubenslüge Nr. 6: Gott hat einen Plan für dein Leben“. Manuel Schmid hat sogar ein ganzes Buch mit dem Titel „Gott hat keinen Plan für dein Leben“ geschrieben. Auch Paulus hat dazu eine Meinung, und die lässt sich aus seiner Selbstvorstellung und anderen Aussagen im Römerbrief ableiten. In der neuen Folge von Hasophonie bringe ich das Buch von Manuel Schmid und den Brief des Apostels ins Gespräch miteinander.
Paulus beginnt seinen Brief an die Christen in Rom sehr ungewöhnlich. Seine Einleitung sprengt die Briefkonventionen der Antike. Und seine Selbstvorstellung beginnt er, für ihn untypisch, damit, dass er sich als „Sklave Christi Jesu“ bezeichnet. Wie kann man etwas so Schönes wie die Beziehung zu Jesus mit einer der hässlichsten Institutionen vergleichen, die die Menschheit hervorgebracht hat? Es gibt zwei Deutungsmöglichkeiten: Man kann seine Selbstbezeichnung aus der jüdischen Tradition (vor allem dem Tanach, unserem Alten Testament) erklären oder aus der römischen Stadtkultur. In beiden findet man Möglichkeiten, das Bild der Sklaverei so zu interpretieren, dass man versteht, warum Paulus es gebraucht. Weil man bei ihm oft auf eine ähnliche Alternative stößt, lohnt es sich, an diesem Beispiel zu zeigen, wie man zu einem Ergebnis kommt.
Es ist um das Jahr 56. Paulus sitzt in Korinth und diktiert seinem Schreiber Tertius einen Brief an die Christen in Rom. Dieser Brief sollte zu einer der einflussreichsten Schriften der Geschichte werden. Lange Zeit hielt man ihr für einen „Abriss der christlichen Lehre“ (Melanchthon), die finale systematische Darstellung der Theologie des Apostels. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich zunehmend die Einsicht durchgesetzt, dass auch der Römerbrief – wie die anderen Paulusbriefe – ein Situationsbrief ist. Sein Aufbau und Inhalt sind bestimmt von der schwierigen Situation, in der sich die Christen in Rom gerade befinden, und von einem Anliegen, das Paulus an sie hat. Auch er ist gerade in einer heiklen Lage, und wenn er die römischen Christen als Unterstützer gewinnen will, muss er zunächst einige Missverständnisse aufklären, die seine Lehre für viele verdächtig gemacht haben. Diesen Hintergrund stelle ich in der neuen Folge von Hasophonie vor, mit der ich meine Auslegung des Römerbriefs beginne. Und ich führe schon einmal zwei weitreichende Konsequenzen an, die sich aus dieser Sicht des Briefes ergeben.
In der neuen Folge von Hasophonie geht es ein letztes Mal um Denkfehler und Trugschlüsse der Bibelauslegung, und als Fallbeispiel spielt wieder die Apostelin Junia aus Römer 16,7 die Hauptrolle. Es gibt zu ihr eine schöne Geschichte, die wir uns genauer anschauen. Mit dieser Geschichte verbindet sich erneut ein Ausflug in die psychologische Gehirnforschung, bei dem wir sehen, warum Menschen vorschnell bloße Vermutungen für gesicherte Erkenntnisse halten – eine Hauptursache für falsche Schlussfolgerungen aus Bibeltexten.
In den letzten Folgen habe ich am Fallbeipiel der Apostelin Junia (Röm 16,7) einige typische Schwachpunkte der Bibelauslegung aufgezeigt. In dieser Folge setze ich das fort. Dabei weitet sich der Horizont von Junia zu anderen Frauen des Neuen Testaments. Es geht um folgende Fragen: (1) Paulus spricht in der Grußliste von Römer 16 von allen Frauen nur Junia den Titel „Apostel“ zu. Was hat Junia, was die anderen nicht haben? (2) Gibt es noch andere Apostelinnen? (3) Können wir einige von ihnen identifizieren? (4) Was macht ihren Apostelstatus aus? Woran erkennen wir, dass eine Frau Apostelin ist? Und schließlich: (5) Wenn Junia unter den Aposteln berühmt ist, warum erfahren wir im NT nicht mehr über sie? Oder vielleicht doch? Während ich diese Fragen beantworte, illustriere ich einen weiteren häufigen Auslegungsfehler: die „selektive Wahrnehmung“. Sie besteht darin, dass man Aussagen in der Bibel einfach nicht wahrnimmt, die nicht den eigenen Erwartungen entsprechen, obwohl sie klar vor Augen stehen.
In dieser Folge geht es um die wichtigste und häufigste Fehlerquelle für Bibelauslegungen – den sogenannten Bestätigungsfehler. Er besteht darin, dass wir Bibeltexte nicht sagen lassen, was sie sagen, sondern sie im Sinne vorgefasster Überzeugungen umdeuten. Ich illustriere ihn mit einem informativen Streifzug durch 2000 Jahre frauenfeindlicher Theologiegeschichte. Dabei komme ich darauf zu sprechen, wie die Reformation und die Katholische Kirche eine große Chance vertan haben. Und ich erzähle, wie die Theologin Bernadette Brooten die weibliche Junia wiederentdeckte, nachdem alle Welt sie zu einem Mann erklärt hatte.
Ich habe mich jetzt einige Wochen lang intensiv mit „Kognitiven Verzerrungen“ beschäftigt, mit all den Tricks, die unser Gehirn drauf hat, um uns in die Irre zuführen. Es gaukelt uns Wahrscheinlichkeiten vor, lässt uns Fehlschlüsse als logisch erscheinen und vermittelt uns Gewissheit auch da, wo wir falsch liegen. Das tut es leider auch in der Bibelauslegung – bei jedem, vom einfachen Bibelleser bis zum Fachtheologen. In der neuen Folge meines Podcasts fange ich an, einige der wichtigsten kognitiven Verzerrungen vorzustellen. Es geht zuerst um den „Verfügbarkeitsfehler“. Mein Fallbeispiel ist wieder Junia aus Römer 16,7. Nebenbei erkläre ich, warum Leute lieber über Asylrecht diskutieren als über Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich begründe, warum wir uns bei der Frage nach der Ordination von Frauen nicht allzu sehr von 1. Korinther 14 und 1. Tim 2 beeindrucken lassen sollten. Und ich erzähle, warum ich viel Literatur von Leuten lese, die eine andere theologische Richtung vertreten als ich. Ich brauche sie, um kognitiv etwas weniger verzerrt zu sein und meine eigenen Irrtümer so weit wie möglich zu verringern.
In dieser Folge beschäftige ich mich mit der Fehleranfälligkeit von Bibelauslegungen. Einige Ursachen von Denkfehlern und Trugschlüssen zeige ich an einem Fallbeispiel – dem Streit um eine Junia aus Römer 16,7: „Grüßt Andronius und Junia … die berühmt sind unter den Aposteln.“ Zwei Fragen haben in den vergangenen 50 Jahren die Gemüter erhitzt: War Junia eine Frau oder ein Mann? Und wenn sie eine Frau war, war sie auch eine Apostelin oder genoss sie nur einen guten Ruf bei den Aposteln? Vor 50 Jahren waren fast alle überzeugt, dass Junia ein Mann ist. Heute gehen die meisten von einer Apostelin Junia aus. Sie ist ein wichtiges Argument für Frauen, die in ihren Kirchen für Gleichberechtigung kämpfen. Für die, die das verhindern wollen, ist sie ein lästiges Argument. Wegen dieser Bedeutung zeichne ich die Schritte genau nach, die zum Ergebnis führen, dass Junia eine Frau sein muss. Ich tue das so niederschwellig und anschaulich wie möglich, damit alle nachvollziehen können, warum wir uns hier inzwischen auf sicherem Boden bewegen. Außerdem können so Leute, die sich bisher kaum oder gar nicht mit Theologie beschäftigt haben, aber neugierig sind, was die Experten eigentlich so machen, einmal einen Einblick gewinnen, wie neutestamentliche Wissenschaft arbeitet. Sie gleicht oft einer minutiösen Detektivarbeit, mit der geduldig Indizien zusammengetragen werden, um zu einem Ergebnis zu kommen. Aber wie alles Menschliche, kennt auch diese Detektivarbeit Licht und Schatten. Es gibt Sternstunden und wichtige Entdeckungen, aber auch dunkle Kapitel, Fake News und Blindheit für Fakten.