Discover ZUKUNFT STADT
ZUKUNFT STADT

ZUKUNFT STADT
Author: Fakultät für Architektur und Raumplanung, TU Wien
Subscribed: 11Played: 166Subscribe
Share
© Fakultät für Architektur und Raumplanung, TU Wien
Description
ZUKUNFT STADT – Ein Podcast der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien zu aktuellen Themen der Stadtentwicklung und der gebauten Umwelt.
Im Podcast sind neben öffentlichen Veranstaltungen auch spannende Gesprächsrunden zu vertiefenden Themen zu hören, es werden Publikationen von Kolleg:innen vorgestellt und Einblicke in Forschung und Lehre an der Fakultät gegeben.
instagram.com/zukunftstadt.podcast
ar.tuwien.ac.at
Im Podcast sind neben öffentlichen Veranstaltungen auch spannende Gesprächsrunden zu vertiefenden Themen zu hören, es werden Publikationen von Kolleg:innen vorgestellt und Einblicke in Forschung und Lehre an der Fakultät gegeben.
instagram.com/zukunftstadt.podcast
ar.tuwien.ac.at
45 Episodes
Reverse
Diese Folge des ZUKUNFT STADT Podcasts widmet sich dem künstlerischen Forschen im Spannungsfeld von Architektur, Raumplanung und Wissenschaft. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach Erkenntnisformen jenseits standardisierter Methoden, nach dem Verhältnis von künstlerischem Handeln und wissenschaftlicher Reflexion sowie nach institutionellen Bedingungen, unter denen künstlerische Forschung sichtbar, anerkannt und weiterentwickelt werden kann.In einem einführenden Gespräch reflektiert Karin Harather ihre langjährige Arbeit an der Schnittstelle von Kunst, Lehre und Forschung an der TU Wien. Im zweiten Teil diskutiert sie mit Alexander Damianisch, Theresa Schütz und Rudolf Scheuvens zentrale Perspektiven auf künstlerische Forschung, ihre methodischen Besonderheiten und ihre Bedeutung für Transformationsprozesse in Stadt und Raum.Ausgangspunkt des Gesprächs ist das von Karin Harather kuratierte Symposium „Kunst schafft Wissen“.Alexander Damianischist Direktor des Zentrum Fokus Forschung an der Universität für angewandte Kunst Wien und Leiter der Abteilung Support Art and Research. Er ist Mitglied der Leitungsgremien der Society for Artistic Research und des Angewandte Innovation Laboratory sowie Delegierter beim Austrian Science Fund (FWF). Seine Arbeit konzentriert sich auf die institutionelle Entwicklung, Förderung und internationale Verankerung künstlerischer Forschung.Karin Haratherhat an der Akademie der bildenden Künste Wien studiert und an der Hochschule für angewandte Kunst promoviert. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Kunst und Gestaltung an der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Im Rahmen ihrer künstlerischen Raumforschung und forschungsgeleiteten Lehre initiiert sie co-kreative Prozesse, entwickelt 1:1-Test-Settings und Reallabore im Bestand.Rudolf Scheuvens ist Dekan der Fakultät für Arch. und Raumplanung. Seit 2008 ist er Professor für örtliche Raumplanung und Stadtentwicklung an der TU Wien und gleichzeitig Mitbegründer und Gesellschafter von Raumposition in Wien und Gesellschafter des Planungsbüros scheuvens + wachten plus in Dortmund. Örtliche Raumplanung TU Wien, Raumposition, scheuvens + wachten plus.Theresa Schützsetzt sich in künstlerisch forschenden und transdisziplinären Projekten mit öffentlichen und sozialen Räumen auseinander. Dabei wird situativ, performativ und direkt gestaltend erkundet, was zwischen uns und dem Anderen, Dingen undOrten verhandelt und sinnlich erfahrbar werden kann. Seit 2015 realisiert Theresa Schütz gemeinsam mit Rainer Steurer als unos Arbeiten zwischen Kunst und Urbanismus, kultureller Vermittlung und Architektur. Parallel vermittelt Theresa Schütz an der TU Wien und anderen Hochschulen, forscht zu Leerstand, Politiken öffentlicher Räume und Handlungsspielräumen von Jugendlichen im öko-sozialen Wandel.Credits PodcastFolge #39Konzept und Moderation: Karin Harather, Madlyn MiessgangAufnahme, Audio und Schnitt: Lisa-Marie Kramer, Madlyn Miessgang und Nico SchleicherZUKUNFTSTADT Podcast Produktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico Schleicher Intro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit demForschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
In der dritten Folge der Mini-Serie zu HouseEurope! werden konkrete Projekte in den Fokus gestellt! Im Rahmen der interdiziplinären Master-Lehrveranstaltung Field Trips, setzten sich die Studierenden aus Architektur und Raumplanung mit konkreten Projekten aus dem Renovation Atlas von HouseEurope! auseinander. In ihren Beiträgen geben Sie einen Einblick in ihre Auseinandersetzungen und zeigen dabei, wie vielfältig die Blickwinkel und Aspekte von Bestandstransformation sein können.Leonie Böhm, Laura Elisa Glatz, Anabel Neuner und Anna-Lena Rehfisch reisten nach Bordeaux zu den Gebäuden G, H und I in der Cité du Grand Parc, die von Lacaton & Vassal transformiert und um große vorgesetzte Loggien erweitert wurden. Sie warfen einen Blick in den Alltag der Bewohner:innen und untersuchten, welchen Einfluss die Transformation auf das Leben vor Ort hat.Die Studierendengruppe rund um Edda Böhm, Matteo Stark, Franziska Wehle und Klara Weinhold reiste nach Brüssel und beschäftigte sich dort mit dem Thema Identität(en) im baulichen Kontext. Dafür besuchten sie das CIVA, das Architekturzentrum in Brüssel, sowohl an seinem alten Standort in Brüssel als auch am zukünftigen Standort im ehemaligen Citroën-Werk, das derzeit umgebaut wird.Eine zweite Gruppe, bestehend aus Cristina Alexa, Max Ganser und Viivi Huusko, reiste ebenfalls nach Brüssel zum COOP nach Anderlecht. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Mühle direkt am Kanal, die zu Arbeitsplätzen, Museum und Café umgebaut wurde. Die Studierenden setzten sich mit Fragen der Zugänglichkeit, der neuen Nutzung und Nutzer:innen sowie dem Mehrwert auseinander, den ein solches Gebäude für Stadt und Quartier bringen kann.In Kopenhagen untersuchten Hannah Speer, Teodora Boneva, Anastasia Khabarova und Jan-Christian Benk das Wohngebäude Frikvarteret im neuen Stadtteil Nordhavn. Sie beschäftigten sich mit dem Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit und damit, welchen Einfluss die Transformation von Bestandsgebäuden auf Stadtentwicklungsziele hat und haben kann. Die Studierenden Laura Sandner, Elisabeth Schröer und Michele Siladji befassten sich mit dem Mataderoin Madrid, einem ehemaligen Schlachthof, der zu einem Kulturareal umgewandelt wurde. In ihrer Arbeit untersuchten sie die stadtpolitischen Dynamiken, die zum Leerstand einer der zentralen Hallen auf dem Areal führten, und wie es dazu kam. Nach Rijeka, die Kulturhauptstadt Europas 2020, reisten Angelika Bauer, Anja Berlinger, Lucienne Trummer und Valentina Gruber. Dort setzten sie sich mit der kulturellen Transformation der Stadt auseinander – vom Industriestandort zur Kulturhauptstadt – und den Herausforderungen, die dies für das Areal des Benčić-Komplexes mit sich bringt. HouseEurope! ist eine parlamentarische Bürgerinitiative auf europäischer Ebene. Ihr Ziel ist es, den Abriss von Gebäuden zu reduzieren und stattdessen Sanierung, Wiederverwendung und Umbau zu fördern. Dahinter steht die Überzeugung, dass der Gebäubestand nicht nur eine ökologische Ressourcer ist, sondern auch eine kulturelle und soziale.Diese Folge ist Teil einer Mini-Serie zur Initiative HouseEurope!, kuratiert von Madlyn Miessgang und Verena Konrad. Alle Informationen zu HouseEurope! sowie die Möglichkeit der Unterzeichnen, finden Sie unter: https://www.houseeurope.euCredits PodcastFolge #38Konzept und Moderation: Madlyn Miessgang, Verena KonradAufnahme, Audio und Schnitt: Lisa-Marie Kramer, Madlyn Miessgang, Nico SchleicherTitelbild: Gruppe Bordeaux, Field Trips 2025ZUKUNFT STADT Podcast Produktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico Schleicher Intro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
Die Folge #37 widmet sich erneut HouseEurope! – einem Anliegen, das sich entschieden für eine Bauwende einsetzt. In dieser Folge richtet sich der Blick auf Wien und Österreich und darauf, wie die Initiative dort wahrgenommen wird.Im Rahmen der Veranstaltung „Power to Renovation“, die im Juni 2025 im Az W (Architekturzentrum Wien) stattgefunden hat, spricht Lene Benz (Az W) mit Christine Dornaus (BIG), Magdalena Lang (IG Architektur), Nicole Büchl (wohnfonds_wien), Daniel Fügenschuh (Bundeskammer der Ziviltechniker:innen) und Verena Konrad (HouseEurope!, vai) über die Ziele der Initiative und deren mögliche Wirkungsweisen in Wien und Österreich.HouseEurope! ist eine parlamentarische Bürgerinitiative auf europäischer Ebene. Ihr Ziel ist es, den Abriss von Gebäuden zu reduzieren und stattdessen Sanierung, Wiederverwendung und Umbau zu fördern. Dahinter steht die Überzeugung, dass der Gebäudebestand nicht nur eine ökologische Ressource ist, sondern auch eine kulturelle und soziale.Diese Folge ist Teil einer Mini-Serie zur Initiative HouseEurope!, kuratiert von Madlyn Miessgang und Verena Konrad und mit Unterstützung durch das Az W (Architekturzentrum Wien). Alle Informationen zu HouseEurope! sowie die Möglichkeit zur Unterzeichnung finden Sie unter: https://www.houseeurope.eu Lene Benz kuratiert und koordiniert seit 2018 das öffentliche Programm am Architekturzentrum Wien, das sich internationalen und lokalen Themen der Architektur und Stadtplanung widmet. Darüber hinaus ist Lene Benz als Moderatorin, Universitätslektorin und Performerin tätig. Nicole Büchl arbeitet seit 2024 beim wohnfond_wien im Bereich der geförderten Wohnhaussanierung und der Unternehmenskommunikation. In den letzten Jahren war sie dort für den Aufbau der Hauskunft - Servicestelle für Wohnhaussanierung verantwortlich und ist mittlerweile als Leiterin für den Bereich der Sanierung tätig.Christine Dornaus ist seit Oktober 2024 in der Geschäftsführung der Bundesimmobiliengesellschaft. Zuvor war die promovierte Handelswissenschaftlerin mehr als zwanzig Jahre in führenden Positionen in der Wiener Städtischen Versicherung AG tätig, seit 2009 als Mitglied des Vorstands. Daniel Fügenschuh ist Architekt und leitet ein Architekturbüro in Innsbruck. Seit 2022 ist er Präsident der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen und vertritt die österreichischen Architekt:innen und Zivilingenieur:innen. Verena Konrad leitet seit 2013 das Vorarlberger Architektur Institut als Kultur- Bildungsorganisation im Bereich Architektur- und Baukulturvermittlung. Sie repräsentiert die europäische Initiative HouseEurope! in Österreich.Magdalena Lang studierte Architektur an der TU Graz. Gemeinsam mit Arch. DI Gernot Kupfer führt sie seit 2012 das MAS_Mojo Architectural Studio in Graz. Seit 2020 engagiert sie sich zudem im Vorstand der IG Architektur, dessen Vorsitz sie 2022 übernommen hat.Credits PodcastFolge #36Konzept und Moderation: Madlyn Miessgang, Verena KonradAufnahme, Audio und Schnitt: Lisa-Marie Kramer, Madlyn Miessgang, Nico Schleicher; Audiomaterial vom Az W zur Verfügung gestellt.ZUKUNFT STADT Podcast Produktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico Schleicher Intro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
In Folge 36 geben wir gemeinsam mit Verena Konrad, österreichische Repräsentantin von HouseEurope! und Direktorin des Vorarlberger Architektur Instituts (vai), einen Einblick in die Bürgerrechtsinitiative HouseEurope!.HouseEurope! ist eine parlamentarische Bürgerinitiative auf europäischer Ebene. Ihr Ziel ist es, den Abriss von Gebäuden zu reduzieren und stattdessen Sanierung, Wiederverwendung und Umbau zu fördern. Dahinter steht die Überzeugung, dass der Gebäudebestand nicht nur eine ökologische Ressource ist, sondern auch eine kulturelle und soziale.Diese Folge ist Teil einer Mini-Serie zur Initiative HouseEurope!, kuratiert von Madlyn Miessgang und Verena Konrad und mit Unterstützung durch das Az W (Architekturzentrum Wien). Alle Informationen zu HouseEurope! sowie die Möglichkeit zur Unterzeichnung finden Sie unter: https://www.houseeurope.euVerena Konrad ist Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Architektur- und Designgeschichte, Kuratorin, Autorin und Kulturmanagerin und leitet seit 2013 das Vorarlberger Architektur Institut als Kultur- Bildungsorganisation im Bereich Architektur- und Baukulturvermittlung. Sie repräsentiert die europäische Initiative HouseEurope! in Österreich.Credits PodcastFolge #36Konzept und Moderation: Madlyn Miessgang, Verena KonradAufnahme, Audio und Schnitt: Lisa-Marie Kramer, Madlyn Miessgang, Nico SchleicherZUKUNFT STADT Podcast Produktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico Schleicher Intro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
In dieser Folge geben wir einen ersten Einblick in die archdiploma 2025 „Nachdenken über den Bestand“, welche Abschlussarbeiten der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien und damit die Themen, die eine neue Generation von Architetk:innen und Planer:innen bewegen, zeigt.In dieser Folge sprechen zu Beginn die Kurator:innen Heike Oevermann und Harald R. Stühlinger über das Konzept und die Bedeutung des Formats. Anschließend erzählen drei Absolvent:innen – Ruth Höpler, Tatjana Riedel und Johannes Paintner – von ihrem Weg durch das Diplom, überMotivation und Methoden, über Herausforderungen im Prozess und darüber, wie sich ihre Themen heute in der Praxis weiterentwickeln. Eine Folge des ZUKUNFT STADT Podcasts inKooperation mit der archdiploma 25.Die Archdiploma findet vom 20. bis 22. Noveber 2025 im Funkhaus in der Argentinierstraße Wien statt.Ruth Höpler studierte Raumplanung an der TU Wien undschloss das Masterstudium 2023 ab. Seit 2020 ist sie am future.lab der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU Wien tätig. Zunächst befasste sie sich mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten und Nutzungsmischung, womit sie sich auch in ihrer Masterarbeit auseinandersetzte. Aktuell arbeitet sie bei unterschiedlichen Projekten im Kontext sozialer Innovations- und Transformationsprozessen in der Stadt- bzw. Raumplanung mit.Heike Oevermann ist promovierte und habilitierteUniversitätsprofessorin für Denkmalpflege und Bauen im Bestand an der TU Wien. Ihr Werdegang ist gekennzeichnet durch vielfache Lehr- und Forschungsstationen in Europa, unter anderem an der Humboldt-Universität zu Berlin, der UniversitàRoma Tre und als Gastdozentin an der Oslo School for Architecture and Design. Mit einem Hintergrund in Architektur und Heritage Studies liegt ihr Forschungsschwerpunkt auf der Transformation, insbesondere von industriellem und städtischem Erbe und Denkmälern sowie Wohnsiedlungen.Johannes Paintner studierte Architektur an der TU Wien undder OTH Regensburg. In seiner Diplomarbeit beschäftigt er sich mit zivilgesellschaftlichem Aktivismus und den Akteur:innen, welche für die Umsetzung der Bauwende eintreten und im speziellen den Erhalt von abrissgefährdeten Gebäuden fordern. Tatjana Riedel studierte Architektur an der TU Wien, wosie ihr Bachelor- und Masterstudium absolvierte und währenddessen als Studienassistentin tätig war. In ihrer Diplomarbeit beleuchtete sie kritisch den Umgang mit Ressourcen in der Bauindustrie und wie sich der Zusammenhang zur Baukultur durch Kunst einem breiteren Publikum vermitteln lässt. .Harald R. Stühlinger studierte Architektur und Kunstgeschichte in Wien und Venedig und promovierte an der ETH Zürich zumWettbewerb zur Wiener Ringstrasse. Derzeit hat er laufende Forschungsprojekte im Bereich der Baukultur und der digitalen Vermittlung von Architektur- und Städtebaugeschichte.Zahlreiche Veröffentlichungen zur Geschichte der Architektur, des Städtebaus und der Fotografie vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Darüber hinaus wirkt er als freier Kurator und realisierte Ausstellungen in der Schirnhalle Frankfurt, ander ETH Zürich, an der Fachhochschule Nordwestschweiz, im Bayt al Sennari (Kairo) sowie im Wiener Rathaus. Im Jahr 2023 erhielt das Kollektiv «Parity Group», dessen Gründungsmitglied Harald R. Stühlinger ist, den renommiertenSchweizer Meret Oppenheim-Preis für deren Engagement im Bereich der Geschlechtergleichstellung im Architekturbetrieb.CreditsFolge #35Konzept und Moderation: MadlynMiessgangAufnahme, Audio und Schnitt: Madlyn Miessgang, Nico SchleicherFotocredits: archdiploma 25ZUKUNFT STADTPodcast Produktion: Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp,Madlyn Miessgang und Nico Schleicher Intro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
Folge #34 widmet sich dem Projekt TIKTAK Galilei. Im Sommersemester 2024 haben 23 Studierende im Rahmen des Masterwahlmoduls Stadt und Landschaft die Galileigasse am Alsergrund in Wien neu gestaltet: Aus einer Wohnstraße wurde eine Fußgänger:innenzone. Ein Jahr später feiern wir den Gewinn des VCÖ Mobilitätspreises Österreich 2025 in derKategorie Kindgerechtes Verkehrssystem sowie eine Auszeichnung beim VCÖ Mobilitätspreis Wien. Das nehmen wir zum Anlass, um noch einmal gemeinsam auf das Projekt zurückzublicken. Lena Hohenkamp (ifoer) hat hierfür Jan Gartner (Raumpioniere) Ronja Gelf (Master Raumplanung), Katrin Hagen (landscape), Philip Krassnitzer (ehem. LA 21) und Alexandra Weber (Master Raumplanung) eingeladen. Gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir darüber, wie das Projekt umgesetzt wurde, welche Hürden es gab, wie aus einerWohnstraße eine Fußgänger:innenzone wurde und welche Chancen in solchen temporären Transformationen stecken.Instagram: @tu.in.actionKurzbios:Jan Gartner ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Raumpioniere, die innovative Projekte im Bereich Placemaking, Tactical Urbanism, Stadtentwicklung und Bürger:innenbeteiligung begleitet. Er studierte Raumplanung an der TU Wien und bringt seine Expertise in der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger, gemeinschaftsorientierter Stadträume ein.Ronja Gelf studierte zunächst Architektur (B.A.) an der Fachhochschule Aachen und arbeitete seit 2019 parallel und anschließend in einem Aachener Architekturbüro. 2023 begann sie das Masterstudium der Raumplanung an der TUWien. Erfahrungen aus der persönlichen Assistenz von Menschen im Rollstuhl haben ihre Sensibilität für Intersektionalität und soziale Gerechtigkeit geschärft und ihre Haltung darin bestärkt, marginalisierte Perspektiven in Planungsprozessen immer mitzudenken. Katrin Hagen ist Senior Scientist am Forschungsbereich Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung der TU Wien. Nach dem Diplom an der TU Hannover arbeitete sie als Planerin in Wien und Andalusien. Seit 2006 ist sie an die TU Wien tätigwo sie 2011 zum Thema Klimawandelanpassung und Freiraumqualität promovierte. Zusätzliche Schwerpunkte in Lehre und Forschung liegen auf innovativen undco-kreativen Umsetzungsprozessen. Derzeit leitet sie das Forschungsprojekt CoCoNet – Co-creative Cohabitation Network (DUT).Lena Hohenkamp ist seit 2022 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien. In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit Tactical Urbanism undPlacemaking aus einer Care-Perspektive und beleuchtet die damit im Zusammenhang stehenden Fragen nach Aneignung, Sorge und sozialer Verantwortung. Philip Krassnitzer studierte Raumplanung an der TU Wien und war anschließend als Projektassistent und später als externerLehrbeauftragter in den Forschungsbereichen Ifoer und Region tätig. Seit September 2024 ist er Praedoc in der Arbeitsgruppe für Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien. Sein Forschungsinteresse gilt dem Verstehen und der Vermittlung komplexer räumlicher Zusammenhänge und Veränderungsprozesse auf lokaler und regionaler Ebene. Alexandra Weber studiert im Master Raumplanung an der TU Wien. Ursprünglich kommend von Kunst und Gestaltung (HTL) ist ihr Blick 2020 zur integrativen Raumplanung im öffentlichen Raum mit den Themenschwerpunkten Klimawandelanpassung, Stadtnatur, Gesundheitsförderung und aktive Mobilität gewandert.Credits Folge #34Konzept und Moderation: Ronja Gelf, Alexandra Weber, Larissa Benk und Lena HohenkampAufnahme, Audio und Schnitt: Lena HohenkampFotocredits: Lena HohenkampZUKUNFT STADT Podcast Produktion: Lukas Bast, Larissa Benk,Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico Schleicher Intro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
Wie sieht ein inklusiver Ort für Alle aus? Dieser komplexen Frage haben sich im vergangenen Sommersemester 19 Studierende in enger Kooperation mit der Gemeinde Lustenau, Praxispartner*innen sowie Lehrenden der TU Wien angenähert und in Vorarlberg ein 1:1 Projekt umgesetzt – entstanden ist A HUUS FÜR D’LÜT. In Folge #33 spricht Larissa Benk mit Sywen Schmidt (Master Raumplanung), Felix Elsner (Master Architektur), Lena Hohenkamp (ifoer TU Wien), Jan Gartner (Raumpioniere – Agentur für StadtmacherInnen) und Corinna Ebner-Trenker (Jugendkoordinatorin Marktgemeinde Lustenau). Wir stellen uns Fragen nach den Vor- und Nachteilen von placemaking-Projekten; nach der Einbindung von Jugendlichen in co-kreative Planungsprozesse; was es braucht, damit Projekte nach der Umsetzung weiter bespielt werden und welche Rolle Sozialraumanalysen in der Raumplanung einnehmen. Außerdem berichten wir aus unseren persönlichen Erfahrungen, was wir gelernt und für weitere Projekte mitgenommen haben.Instagram: @tu.in.actionSywen Schmidt studierte Politikwissenschaft an der Universität Wien und absolvierte zusätzlich einen Bachelor in Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien. Derzeit vertieft sie ihre Kenntnisse im gleichnamigen Masterstudium und ist als studentische Mitarbeiterin an der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien tätig.Felix Elsner absolvierte von 2019 bis 2022 sein Bachelorstudium der Architektur an der Hochschule Wismar. Anschließend arbeitete er von 2022 bis 2023 in Vollzeit in einem Architekturbüro in Hamburg. Seit 2023 studiert er Architektur im Master an der TU Wien.Jan Gartner ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Raumpioniere, die innovative Projekte im Bereich Placemaking, Tactical Urbanism, Stadtentwicklung und Bürger:innenbeteiligung begleitet. Er studierte Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien und bringt seine Expertise in der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger, gemeinschaftsorientierter Stadträume ein.Corinna Ebner-Trenker ist Jugendkoordinatorin der Gemeinde Lustenau in Vorarlberg. Dort dient sie als Schnitt- und Anlaufstelle mit dem Ziel, bedarfsgerechte Leistungen und Unterstützung für junge Menschen zu schaffen. Mit dem Fokus auf Beteiligung und Mitbestimmung junger Menschen initiiert sie in Zusammenarbeit mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Lustenau, mit Vereinen, Initiativen und Kooperationspartner:innen Projekte und setzt diese gemeinsam mit jungen Menschen um. Dabei stehen die eingebrachten Ideen, Anregungen und Wünsche der Jugendlichen im Vordergrund.Lena Hohenkamp ist seit 2022 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsbereich Örtliche Raumplanung an der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit Tactical Urbanism und Placemaking aus einer Care-Perspektive und beleuchtet die damit im Zusammenhang stehenden Fragen nach Aneignung, Sorge und sozialer Verantwortung. Larissa Benk studierte im Bachelor Stadt- und Raumplanung sowie Architektur an der Fachhochschule Erfurt und begann im Oktober 2023 den Master Raumplanung und Raumordnung an der Technischen Universität Wien. Berufserfahrung konnte sie während mehrerer studentischer Assistenzen in Erfurt und bei einem Praktikum in München sammeln. Seit 2024 ist sie am Forschungsbereich Örtliche Raumplanung tätig und unterstützt das Team in Lehre und Administration.Credits Folge #33Konzept und Moderation: Larissa Benk und Lena HohenkampAufnahme, Audio und Schnitt: Larissa Benk und Lena HohenkampFotocredits: Katrin HagenZUKUNFT STADT Podcast Produktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico Schleicher Intro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
#32 Die Alte WU umbauen, aber wie?Im zweiten Teil unserer Mini-Serie zur „Alten WU“ gehen wir im Studio der Frage nach, wie Großstrukturen umgebaut statt abgerissen werden können. Gemeinsam mit Johannes Bretschneider (Urbanism, TU Wien), Ariadne Hinzen (Kollektiv Raumstation), André Krammer (Urbanism, TU Wien) und Lisa Schönböck (Architects for Future) diskutieren wir über Gründe für einen Bestandserhalt jenseits der Denkmalpflege, welche Herausforderungen bei der Transformation von Megastrukturen auftreten und was es für eine erfolgreichen Umbau von Großstrukturen benötigt. Gäste: Johannes Bretschneider (Urbanism, TU Wien), Ariadne Hinzen (Kollektiv Raumstation), André Krammer (Urbanism, TU Wien), Lisa Schönböck (Architecture for Future Austria)Moderation:Lukas Bast (ZUKUNFT STADT) Johannes Bretschneider lehrt und forscht am Forschungsbereich Städtebau und Entwerfen an der TU Wien. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist das Verhältnis von Großstrukturen und Stadt. U. a. war er bereits im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit dem Areal befasst.https://urbanism-tuwien.at/ Ariadne Hinzen ist Mitglied des Kollektiv Raumstation. Die Raumstation ist selbst in der Alten WU zuhause und arbeitet mit experimentellen Raumerkundungsmethoden, künstlerisch-aktivistischen Interventionen und aktivierenden Prozessen im städtischen Raum.https://raumstation.org/Andre Krammer ist Architekt und Urbanist in Wien. Er hat laufende Lehraufträge an der TU Wien (am Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen und am Institut für Architektur und Entwerfen) und ist Redakteur von dérive – Zeitschrift für Stadtforschung.Lisa Schönböck studierte Architektur in Wien und ist seither im Bildungsbau tätig. Weiterbauen und der Umgang mit Bestand sind dabei zentralen Themen. Sie ist Vorstandsmitglied von Architects for Future Austria. https://architects4future.at/Weiterführende Hinweise Kollektiv Raumstation – https://raumstation.org/Forschungsbereich Städtebau & Entwerfen, TU Wien – https://urbanism-tuwien.at/Architects for Future Austria – https://architects4future.at/Allianz Alte WU – https://allianzaltewu.at/ Credits Folge #32Konzept: Lukas Bast und Ariadne HinzenAufnahme, Audio und Schnitt: Lukas BastZUKUNFT STADT Podcast – Produktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang, Nico SchleicherIntro-Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien; produziert in Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung.
In dieser Folge laden wir zu einem Spaziergang durch das Universitätszentrum Althangrund ein – besser bekannt als die „Alte WU“. Gemeinsam mit Ariadne Hinzen vom Kollektiv Raumstation und Johannes Bretschneider vom Forschungsbereich Städtebau und Entwerfen der TU Wien erkunden wir das ehemalige Hauptgebäude der Wirtschaftsuniversität Wien sowie das benachbarte ehemalige Biologiezentrum.Wir sprechen über die räumliche Struktur des Areals, die architektonischen Vorstellungen seiner Entstehungszeit, aktuelle Formen der Zwischennutzung und die Auseinandersetzung mit geplanten Um- oder Rückbauten. Neben den räumlichen Dimensionen und Planungsparadigmen richtet sich der Blick auch auf die aktuellen Nutzungen: Wir besuchen das Arashi Collective, das einen ehemaligen Hörsaal als Bewegungsraum nutzt, das Papageienschutzzentrum im alten Biologiezentrum, in dem heute über 200 Tiere betreut werden und kehren ein ins raum café, dessen Einrichtung aus Möbeln des universitären Möbellagers zu einer wunderbaren Kaffeehauslandschaft arrangiert wurde.Ariadne Hinzen ist Mitglied des Kollektiv Raumstation. Die Raumstation ist selbst in der Alten WU zuhause und arbeitet mit experimentellen Raumerkundungsmethoden, künstlerisch-aktivistischen Interventionen und aktivierenden Prozessen im städtischen Raum.Johannes Bretschneider lehrt und forscht am Forschungsbereich Städtebau und Entwerfen an der TU Wien. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist das Verhältnis von Großstrukturen und Stadt. U. a. war er bereits im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit dem Areal befasst.Arashi Collective ist ein Kollektiv für Bewegungskunst und nutzt seit 2023 einen ehemaligen Hörsaal der „Alten WU“ als Trainingsraum für Akrobatik, Martial Arts und zeitgenössische Körperpraxis.Dietmar Bobacz ist Vizepräsident des Papageienschutzzentrums, das im ehemaligen Biologiezentrum am Universitätszentrum Althangrund über 200 Papageien beherbergt. Credits Folge #31Konzept und Moderation: Lukas Bast und Ariadne HinzenAufnahme, Audio und Schnitt: Lukas BastFotocredits: Lukas BastZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico SchleicherIntro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
In Folge #30 dreht sich alles um eine zentrale Frage der Energiewende: Wie kann Strom gemeinschaftlich produziert und genutzt werden – vor allem in Städten? Lena Hohenkamp spricht mit Andreas Bernögger vom future.lab, Katrin Burgstaller vom Energieinstitut der JKU Linz und Wolfgang Haider vom Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) über das Forschungsprojekt UrbEnPro (Urban Energy Posumption). Gemeinsam werfen sie einen Blick auf das Konzept des Prosumierens (gleichzeitiges Produzieren und Konsumieren von Energie), (neue) rechtliche Rahmenbedingungen für die gemeinschaftliche Energieerzeugung, die Frage, warum gemeinschaftliche Stromproduktion im urbanen Raum bislang kaum verbreitet ist – und welche Hebel es braucht, um das zu ändern, und vor allem: den Beitrag sozialer Innovationen zur Energiewende.UrbEnPro wird durch den Österreichischen Klima- und Energiefonds im Rahmen des Austrian Climate Reseach Programme (ACRP) gefördert. UrbEnPro Workshop, 17.10.2025, 10 Uhr via Zoom. Mehr Infos und Link zur Veranstaltung: https://futurelab.tuwien.ac.at/research-center/urbane-transformation/research/urbenpro/zukunftsworkshopsAndreas Bernögger studierte Raumplanung an der TU Wien und Urban Design an der TU Berlin. Seit 2017 ist er wissenschaftlich sowie in der Moderation, Prozessbegleitung und Strategieentwicklung tätig. Im Zentrum stehen dabei Lern- und soziale Innovationsprozesse zu den Themen Wohnen, Mobilität, Energie und integrierte Entwicklung von Quartieren, Städten und Regionen. Aktuell ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am future.lab der Fakultät für Architektur + Raumplanung an der TU Wien.Katrin Burgstaller studierte Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz mit dem Schwerpunkt Staat, Gesellschaft und Politik. Während ihres Studiums war sie als studentische Mitarbeiterin am Institut für Staatsrecht und Politikwissenschaft beschäftigt. Seit Mitte 2020 ist sie Mitglied des juristischen Teams der Abteilung Energierecht am Energieinstitut an der JKU Linz und tätig als Junior Researcher. Der Fokus ihrer Forschungsarbeit liegt auf rechtlichen und regulatorischen Aspekten des Strommarktes, Energiegemeinschaften, Blockchain, Datenerhalts und Datenflusses von Energiedaten, Datenschutz, Energieeffizienz, sektorkoppelnden Speicherung von Energie und Herkunftsnachweise.Wolfgang Haider ist seit 2015 als Forscher und Projektleiter am Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) in Wien tätig. Seine Arbeit konzentriert sich auf transdisziplinäre Innovationsforschung mit Fokus auf sozial‑ökologische Transformation, soziale Innovation und Governance im Kontext der Energie‑ und Nachhaltigkeitstransition. Aktuell koordiniert er die Social Innovation Mission Facility, eine EU‑finanzierte Initiative zur Stärkung sozialer Innovationen im Rahmen der EU‑Missionen, insbesondere im Bereich Boden und Landnutzung. Zuvor leitete er das H2020‑Projekt RIPEET, das sich mit dem Design, der Implementierung und Bewertung transformativer Innovationsprozesse im Energiesystem befasste. Darüber hinaus forscht er u. a. zu sozialen Dimensionen urbaner Prosumptions‑Modelle, experimentellen Governanceansätzen und der Rolle sozialer Innovation für klimaresiliente Stadt‑ und Regionalentwicklung. Credits Folge #30Konzept und Moderation: Lena HohenkampAufnahme, Audio und Schnitt: Lena HohenkampZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico SchleicherIntro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
Ausgehend vom EU-geförderten Forschungsprojekt EXIT sprechen Larissa Benk und Lisa-Marie Kramer in Folge #29 mit Adrienne Homberger, Slađana Adamović und Daniele Karasz vom Forschungsbereich Soziologie über ihren aktuellen Forschungsstand auf dem Weg zu nachhaltigen Strategien gegen territoriale Ungleichheiten.Gemeinsam hinterfragen sie das Konzept der left behind places und setzen ihm einen differenzierten, intersektionalen Forschungszugang entgegen. Dabei teilen sie Einblicke aus ihrer ethnografischen Arbeit in den in Österreich untersuchten Regionen rund um Ternitz (Niederösterreich) und Jennersdorf (Burgenland). Deutlich wird: Wer territoriale Ungleichheiten wirksam adressieren will, muss den Blick auf den Bestand nicht nur baulich-räumlich, sondern vor allem sozial denken, als Netz aus Beziehungen, Erfahrungen und lokalen Ressourcen.KurzbiosAdrienne Homberger ist Kultur- und Sozialwissenschaftlerin und seit 2021 an der TU Wien am Forschungsbereich Soziologie tätig. Zurzeit ist sie Projektmitarbeiterin im Projekt EXIT. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit sozialer und territorialer Ungleichheit, Prekarität, Flucht und Migration, sowie mit Rassismus und Gender. Slađana Adamović ist Kultur- und Sozialanthropologin (Universität Wien) und sozialwissenschaftliche Forscherin. Derzeit ist sie am Institut der Soziologie als Prae-Doc im Rahmen des Forschungsprojekts Identität im Kontext von Krieg und Migration tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in der intersektionalen Migrations- und Genderforschung. Sie arbeitete als wissenschaftliche Projektmitarbeiterin am Institut für Raumplanung an der TU Wien für das Projekt EXIT.
Daniele Karasz arbeitet v.a. zu Themen der Migration, des Wohnens und der Stadtentwicklung. An dieser thematischen Schnittstelle liegt der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen und anwendungsorientierten Forschung. Insbesondere die Frage des Zusammenwirkens anthropologischer Kompetenzen mit planungsorientierten Disziplinen beschäftigt seine Arbeit seit Jahren. Daniele Karasz ist Senior Lecturer am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien. Am Forschungsbereich Soziologie der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien koordiniert er das Projekt EXIT. Daniele Karasz ist Mitbegründer von Search and Shape, Institut für angewandte Sozialwissenschaft in Wien.CreditsFolge #29Konzept und Moderation: Larissa Benk und Lisa-Marie KramerAufnahme, Audio und Schnitt: Larissa Benk und Lisa- Marie Kramer Fotocredits: Slađana Adamović, Lisa-Marie Kramer, Magdalena Prade ZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico SchleicherIntro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
Folge #28 widmet sich mit der Frage nach den Besonderheiten eines praxisnahen Lehrzugangs der landuni Drosendorf als gelebten Ort der Bestandstransformation. Dafür sprechen Larissa Benk und Madlyn Miessgang mit Sibylla Zech und Benjamin Altrichter vom Forschungsbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung und mit der Drosendorf-Bewohnerin Susanne Meiringer.Diskutiert wird unter anderem, inwiefern neue Lehrformate und das Geschehen rund um die landuni sowohl Studierenden, Forschenden als auch Bewohner:innen der Region einen Perspektivwechsel ermöglichen; es geht um die Frage, wie es überhaupt zur Idee einer landuni gekommen ist, welche Impulse von ihr bereits ausgingen und zukünftig ausgehen sollen sowie um ein erweitertes Begriffsverständnis vom Bestand in seinen räumlichen, kulturellen und sozialen Dimensionen. Sibylla Zech ist Raumplanerin und Professorin für Regionalplanung und Regionalentwicklung an der TU Wien. Als eine der Initiator:innen der landuni kennt und nutzt sie die Chancen des Lehrens, Lernens und Forschens draußen im realen Raum. Ihre Planungs- und Forschungsschwerpunkte sind Stadt- und Regionalentwicklung, Baukultur, ökologisch und soziokulturell orientierte Raumplanung, kommunikative Planungsprozesse und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.Susanne Meiringer ist Volkskundlerin und Kunsthistorikerin. Die Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf lernte sie durch Sommerfrischeaufenthalte kennen, wo sie mit ihrer Familie eine Landwirtschaft führte und heute noch lebt. Beruflich war sie im Stadtmuseum Waidhofen/Thaya tätig. Heute engagiert sie sich in mehreren Vereinen, arbeitet als Stadtführerin in Drosendorf und ehrenamtlich im Weltladen in Horn.Benjamin Altrichter ist Architekturschaffender und Projektassistent an der TU Wien. Er ist Mitgründer des Vereins Die Ruranauten – Pioniere für eine neue ländliche Baukultur und seit 2022 Vorstandsmitglied des Vereins LandLuft. Seine Praxis- und Forschungsschwerpunkte liegen in partizipativen Transformationsprozessen ländlicher Räume und der baukulturellen Bewusstseinsbildung.Credits Folge #28Konzept und Moderation: Larissa Benk und Madlyn MiessgangAufnahme, Audio und Schnitt: Larissa Benk und Lisa-Marie Kramer Fotocredits: Benjamin Altrichter ZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico SchleicherIntro Musik: Jakob KotalDiese Folge ist Teil der Mini-Serie zur „Transformation in der Lehre“, kuratiert von Lisa-Marie Kramer und Madlyn Miessgang.Der Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
In Folge 27 spricht Lena Hohenkamp (Örtliche Raumplanung, TU Wien) mit Emanuela Semlitsch und Kerstin Pluch (Örtliche Raumplanung, TU Wien) sowie Johannes Suitner (Stadt- und Regionalforschung, TU Wien) darüber, was Entwerfen in der Raumplanung heute eigentlich heißt – und welche unterschiedlichen Perspektiven wir darauf einnehmen können.Es geht um Maßstäblichkeit und was passiert, wenn man den Maßstab wechselt, um Vermittlung als zentrale Kompetenz in der Raumplanung, um Ausbildung und Bildung sowie die Frage, wie wir lernen, kritisch zu denken, Position zu beziehen und Verantwortung zu übernehmen. Und wir schauen auf das Arbeiten vor Ort, also im echten Raum – dort, wo Planung konkret wird. Buchreferenz: Theorie der Unbildung, Konrad Paul Liessmann Kerstin Pluch studierte Architektur an der TU Wien und der ETSAM in Madrid. Sie arbeitete u. a. für die MA18, die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank und Architekturbüros in Wien und Madrid und lehrt seit 2017 an der TU Wien. Im Rahmen ihrer Dissertation forscht sie zum Wohnort als Planungsinstrument – mit Fokus auf soziale und räumliche Gerechtigkeit sowie zur Rolle von Lage als Gemeingut. Emanuela Semlitsch lehrt und forscht seit 2018 am Forschungsbereich Örtliche Raumplanung. Ihre Dissertation „Spielraum lassen. Performative Interventionen im Kontext der Stadt“ (2012) entstand aus ihrer Theaterarbeit im öffentlichen Raum heraus. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in urbanen Bildungsräumen, performativen Strategien in Planung und Forschung sowie entwurfs- und praxisbasierte Forschung. Sie ist Mitglied im Forschungsteam „Arbeitsraum Bildung“ an der Fakultät für Architektur und Raumplanung. Johannes Suitner ist Assistenzprofessor für urbane und regionale Transformation am Forschungsbereich Stadt- und Regionalforschung. Er forscht zu Kulturen und Politiken lokaler Nachhaltigkeitstransformationen, resilienten Städten, Imaginaries ökosozialer Zukunft und zur Transformation der Planung. Lena Hohenkamp studierte Betriebswirtschaft an der Universität Regensburg sowie Raumplanung an der TU Wien und der ENSA Strasbourg. Praxiserfahrung in der örtlichen Raumplanung sammelte sie in Le Vésinet, Frankreich, Hamburg und bei der Stadt Wien, MA 21B. Im Rahmen ihrer Dissertation forscht und lehrt sie zu Tactical Urbanism und Placemaking.CreditsFolge #27Konzept und Moderation: Lena HohenkampAufnahme, Audio und Schnitt: Lena Hohenkamp und Larissa BenkZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico SchleicherIntro Musik: Jakob KotalDiese Folge ist Teil der Mini-Serie zur „Transformation in der Lehre“, kuratiert von Lisa-Marie Kramer und Madlyn Miessgang.Der Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
In Folge #26 des ZUKUNFT STADT Podcasts sprechen Bernadette Krejs, Franziska Orso und Peter Fattinger vom Forschungsbereich Wohnbau und Entwerfen der TU Wien mit Madlyn Miessgang über neue Perspektiven auf das Entwerfen – jenseits der großen Geste. Sie sprechen dabei über Ansätze einer sorgsamen Weiterentwicklung des Bestehenden, bei der Fragen nach Gerechtigkeit, Partizipation und Verantwortung ins Zentrum gerückt werden. Dabei teilen sie Erfahrungen aus ihren Lehransätzen: von Design-Build-Projekten mit direktem Praxisbezug, von feministischer Baugeschichte als Inspiration und Handlungsauftrag und vom Versuch, Lehre als Raum gesellschaftlicher Reflexion zu gestalten.Die Folge ist Teil der Mini-Serie zur „Transformation in der Lehre“, kuratiert von Lisa-Marie Kramer und Madlyn Miessgang.Bernadette Krejs ist Architekturschaffende und Forscherin und derzeit am Forschungsbereich Wohnbau und Entwerfen an der TU Wien tätig. Ihre Arbeiten bewegen sich in einem transdisziplinären Forschungsfeld zwischen Architektur, Wohnbau und Visueller Kultur. Sie ist Teil des queer feministischen Kollektivs Claiming*Spaces sowie Autorin und Herausgeberin zahlreicher Publikationen.Franziska Orso ist Architektin, lehrt und forscht am Forschungsbereich Wohnbau und Entwerfen der TU Wien. Ein zentrales Thema ihrer Arbeit beruht auf dem site & services- Prinzip, welches die physischen Aspekte der informellen Stadt einer formellen Planung zugänglich macht. Dabei werden Instrumente und Möglichkeiten in der Wohnraumproduktion erforscht, die eine prozessuale Offenheit mit neuen räumlichen Qualitäten verbinden.Peter Fattinger ist Associate Professor und leitetdas design.build studio, das er vor 25 Jahren an der TU Wien gegründet hat. Das Spektrum der von Studierenden eigenhändig realisierten Projekte reicht von temporären Installationen bis hin zu permanenten Bildungs- und Gemeinschaftseinrichtungen. Ein besonderer Schwerpunkt wurde dabei in den letzten zehn Jahren auf das Thema Bauen im Bestand gelegt.CreditsFolge #26Konzept und Moderation: Lisa-Marie Kramer und Madlyn MiessgangAufnahme, Audio und Schnitt: Madlyn Miessgang und Nico SchleicherFotocredits: Peter FattingerZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, LenaHohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico SchleicherIntro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanungder TU Wien.
In Folge #25 sprechen wir mit Karin Harather und Renate Stuefer vom Forschungsbereich Zeichnen und Visuelle Sprachen sowie Carla Schwaderer vom Forschungsbereich Gebäudelehre und Entwerfen darüber, welche zentrale Rolle Reallabore bei der Transformation von Bestands- und insbesondere Bildungsräumen spielen. Besonders im Fokus steht die Frage danach, inwiefern sich bestehende Gebäude mit kleinen Interventionen an aktuelle pädagogische und gesellschaftliche Anforderungen anpassen lassen und welche Mehrwerte der gemeinsame künstlerisch-kreative Entwurfsprozess für Studierende, Schüler:innen, Pädagog:innen und weitere Expert:innen hat.Karin Harather ist Künstlerin, promovierte Werkpädagogin und Assistenzprofessorin am Institut für Kunst und Gestaltung 1 an der TU Wien. Im Rahmen ihrer künstlerischen Raumforschung und Lehre initiiert sie co-kreative Prozesse, entwickelt 1:1-Test-Settings und Reallabore im Bestand.Carla Schwaderer ist mit ihrem Studium in Architektur an der TU Wien und in Sozialraumorientierter Sozialer Arbeit als sozialraumorientierte Architektin in unterschiedlichen (Forschungs-)Projekten tätig. Sie beschäftigt sich mit der Raumwahrnehmung, -nutzung und -bedürfnissen von Minderheiten im Rahmen von partizipativen Gestaltungs- und genderbezogenen Empowermentprozessen. Renate Stuefer ist promovierte Architektin, Architekturpädagogin und Mutter von sieben Kindern. Sie lehrt und forscht am Institut für Kunst und Gestaltung 1 an der TU Wien zu Forschungs- und Projektschwerpunkten wie Lernumgebungen und Baumaterialien für aktive selbstbestimmte Lernprozesse. Links zu den ProjektenHOPE Raumlabor #Bildungslandschaften im KlimawandelBiB-Lab / Innovationslabor für Bildungsräume in BewegungICH BRAUCHE PLATZ! Künstlerische Co-Creation und Raumforschung mit jungen Menschen in drei Wiener StadtentwicklungsgebietenStadtlabor OPENmarx / PLACE OF IMPORTANCE. Gestaltung sozialintegrativer Bildungsräume im Kontext von Flucht und AsylDISPLACED. Ein kunstbasiertes, sozialintegratives Lehr- und ForschungsprojektCreditsFolge #25Konzept und Moderation: Lisa-Marie Kramer und Madlyn MiessgangAufnahme, Audio und Schnitt: Lisa-Marie Kramer und Madlyn MiessgangFotocredits: Norbert Lechner und Caroline Maria LechnerZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn Miessgang und Nico SchleicherIntro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
In Folge #24 sprechen Lisa-Marie Kramer und Madlyn Miessgang mit Susann Ahn und Katrin Hagen vom Forschungsbereich Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung an der TU Wien über neue Perspektiven auf Freiraum als lebendigen, gemeinschaftlich gestalteten Bestandteil unserer Umwelt. Mit einem erweiterten Bestandsbegriff diskutieren die beiden, wie Planung als Prozess verstanden werden kann, der den Ort in seiner Tiefe „lesen“ lernt und Bestehendes weiterentwickelt. Ob durch temporäre Interventionen oder 1:1-Projekte: Im Zentrum steht immer das gemeinsame Entwerfen mit Menschen vor Ort – experimentell, interdisziplinär und realitätsnah. Wir fragen danach, warum öffentlicher Raum dafür stets neu ausgehandelt werden muss, warum Studierende in echten Prozessen lernen sollten und wieso es Mut braucht, um wieder Visionen zu entwickeln.Susann Ahn ist Professorin für Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung an der TU Wien. Zuvor war sie in Forschung und Lehre an der TU München sowie der ETH Zürich tätig, an der sie auch promovierte. Als Landschaftsarchitektin, Mediatorin und Stadtplanerin leitet sie das Büro Ahn Landscape Mediation und ist Gesellschafterin im Büro adribo GbR – Modernes Konfliktmanagement. Ihr Fokus in Wissenschaft, Praxis und Lehre liegt auf der Schnittstelle von Landschaftsarchitektur und Kommunikation – insbesondere auf co-kreativen sowie konfliktlösenden Methoden in Planung und Entwurf. Im Jahr 2021 wurde sie gemeinsam mit Prof. Thomas E. Hauck an die TU Wien berufen.Katrin Hagen ist Senior Scientist am Forschungsbereich Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung der TU Wien. Nach dem Diplom an der TU Hannover arbeitete sie als Planerin in Wien und Andalusien. Seit 2006 ist sie an die TU Wien tätig wo sie 2011 zum Thema Klimawandelanpassung und Freiraumqualität promovierte. Zusätzliche Schwerpunkt ein Lehre und Forschung liegen auf innovativen und co-kreativen Umsetzungsprozessen, wie im Rahmen des Forschungsprojektes LiLa4Green (Smart Cities Demo) und verschiedenen 1:1 Entwerfen mit Studierenden der Architektur und Raumplanung. Derzeit leitet sie das Forschungsprojekt CoCoNet – Co-creative Cohabitation Network (DUT).Diese Folge ist Teil der Mini-Serie zur „Transformation in der Lehre“, kuratiert von Lisa-Marie Kramer und Madlyn Miessgang.CreditsFolge #24Konzept und Moderation: Lisa-Marie Kramer und Madlyn MiessgangAufnahme, Audio und Schnitt: Lisa-Marie Kramer und Madlyn MiessgangFotocredits: Suann Ahn und Katrin HagenZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp, Madlyn MiessgangIntro Musik: Jakob KotalDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.
Wie verändert sich die Entwurfsausbildung im Städtebau angesichts wachsender ökologischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Herausforderungen? In dieser Folge sprechen wir mit Nela Kadić und Dorothee Huber vom Forschungsbereich Städtebau über den Wandel in Lehre, Forschung und Praxis – vom klassischen Masterplan zur flexiblen, kontextsensiblen Planung im Bestand. Mit einem besonderen Fokus auf die Rolle von Analyse, Kommunikation und Kollaboration, erzählt diese Folge vom Alltag in der Entwurfsausbildung – zwischen kreativem Freiraum, strukturellen Hürden und einem klaren Ziel: Die nächste Generation von Planer:innen zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Dorothee Huber ist Universitätsassistentin an der TU Wien am Forschungsbereich Städtebau und Entwerfen. Der Fokus ihrer Arbeit ist stark im städtebaulichen Kontext verankert und thematisiert urbane Phänomene zu Nutzungsmischung, sozialer Inklusion und Produktionswelten.Nela Kadić ist Senior Lecturer am Forschungsbereich Städtebau und Entwerfen mit Schwerpunkt Urbanismus in Südosteuropa. Für ihre Dissertation forscht sie derzeit zur territorialen Urbanisierung entlang von Schienenlandschaften im Westbalkan. https://urbanism-tuwien.at CreditsFolge #23Konzept und Moderation: Lisa-Marie Kramer und Madlyn MiessgangAufnahme, Audio und Schnitt: Lisa-Marie Kramer und Madlyn MiessgangFotocredits: Johannes Bretschneider*Zitat Titel: Pohl von Denkstatt sàrl aus BaselDiese Folge knüpft an Folge #18 „Transformation der Entwurfslehre“ an und ist Teil der Mini-Serie zur „Transformation in der Lehre“, kuratiert von Lisa-Marie Kramer und Madlyn Miessgang.ZUKUNFT STADT PodcastProduktion: Lukas Bast, Larissa Benk, Lisa-Marie Kramer, Lena Hohenkamp und Madlyn MiessgangIntro Musik: Jakob Kotal
In Folge 22 spricht Barbara Steinbrunner mit ihren Gästen Barbara Birli, Elias Grinzinger, Nina Sillipp und Josef Ramharter über die Dimensionen von Bewusstseinsbildung im Kontext des Bodenschutzes. In der dritten Folge der Miniserie BODEN IM FOKUS sprechen die Vertreter:innen aus Politik, Forschung, und Praxis über ihre Erfahrungen mit neuen Tools und Methoden u.a. zu den Ergebnissen des Forschungsprojektes Soil Walks der TU Wien gemeinsam mit Umweltbundesamt und Wallenberger & Linhard Regionalberatung KG. Finanziert wird das Projekt Soil Walks im Rahmen des Ressortforschungsprogramms über dafne.at mit Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.Hier geht es zum Soil Walks Dashboard.Kurzbios:Josef Ramharter ist seit Juni 2021 Bürgermeister der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya. Nach der Matura an der Handelsakademie Waidhofen an der Thaya war er 25 Jahre in der Baubranche tätig (kaufmännische Geschäftsführung eines Bauunternehmens mit ca. 200 Mitarbeiter:innen), danach 6 Jahre in einem holzverarbeitenden Unternehmen als Vertriebsleiter. DIin Dr.in Barbara Birli ist Expertin für Boden- und Flächenmanagement im Umweltbundesamt. Sie beschäftigt sich mit Boden in der Umweltverträglichkeitsprüfung, mit Bodengefährdungen und der systematischen Entscheidungshilfe für Bodennutzung. Sie leitet und beteiligt sich an nationalen und internationalen Projekten. Ein besonderes Anliegen sind ihr Citizen Science Projekte und Umweltpädagogik zum Boden- und Flächenmanagement.Mag. Nina Sillipp hat Raumforschung und Raumordnung mit Schwerpunkt Regionalentwicklung am Institut für Geographie und Regionalforschung an der Uni Wien studiert und ist seit 2006 Mitarbeiterin der Wallenberger & Linhard Regionalberatung in Horn (NÖ). Sie ist unter anderem in den Bereichen Standortvermarktung und Leerstandsmanagement tätig und ist verantwortlich für das Kommunale Standort-Informationssystem (KOMSIS). Dabei handelt es sich um eine Leerstandsdatenbank für Gemeinden in Österreich, um Leerstand zu erfassen, zu bearbeiten und beiVerfügbarkeit zu vermarkten.DI Elias Grinzinger hat Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien studiert. Er arbeitet und forscht im Bereich Ortskernstärkung, Leerstandsaktivierung, Energie- und Mobilitätswende, Bewusstseinsbildung und Digitale Tools am Forschungsbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung an der TU Wien. In seiner Diplomarbeit befasste er sich mit der WebGIS-gestützten Erfassung und Kommunikation überörtlicher Planungen.
In Folge #21 diskutiert Barbara Steinbrunner mit ihren Gästen Sarah Haider-Nash, Christina Hummel und Elmar Juen die Frage, welchen Beitrag die Zivilgesellschaft in ihren verschiedensten Organisationsformen zum Bodenschutz leisten kann. Ausgangspunkt ist dabei ihre gemeinsame Teilnahme am 2. Österreichischen Transformationsforum in Krems an der Donau. Aus unterschiedlichen Rollen heraus, reflektieren sie dabei den Ansatz und die Wirkung dieser Veranstaltung auf die Bereiche ihres zivilgesellschaftlichen Engagements. Diese Folge ist der zweite Teil der Reihe BODEN IM FOKUS. Im Verlauf der dritten Staffel freuen wir uns auf weitere Folgen mit Barbara Steinbrunner und spannenden Gesprächen rund um Bodenpolitik und -schutz. Dr. Sarah Haider-Nash ist Politikwissenschaftlerin und forscht im Bereich Klimapolitik und Transformation an der Plattform für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Universität für Weiterbildung Krems. Sie ist die organisatorische Leiterin vom Östereichischen Transformationsforum.Dr. Christina Hummel ist Bodenforscherin und koordiniert die Fachgruppe Bodenverbrauch der Scientists4Future Derzeit arbeitet sie an der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zu den Themen Renaturierung degradierter Moore, Bodengesundheit, Ernährungssicherung undKlimawandel.Mag. Elmar Juen hat bis zu seiner Pensionierung als Lehrer fürGeographie & Wirtschaftskunde sowie Musik an einem Oberstufenrealgymnasium unterrichtet. In der Blasmusik übt er die Funktion des Landesobmannes des Blasmusikverbandes Tirol aus und ist Präsidiumsmitglied des Österreichischen Blasmusikverbandes.Fotocredits: Walter Skokanitsch, Elmar Juen und Barbara SteinbrunnerInfos zum PodcastDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.Konzept und Moderation: Barbara SteinbrunnerProduktion, Audio und Schnitt:Lisa-Marie Kramer und Madlyn MiessgangIntro Musik:Jakob Kotal
Unter dem Titel „Eigentum verpflichtet“ sprechen Dragana Damjanovic und Paul Hahnenkamp mit den Studierenden Florian Gehr, Jona Gruse, Sultan Ondrus, Maria Stetter und Bianca Tacha über die Ergebnisse aus dem gleichnamigen Seminar des vergangenen Wintersemesters. Vor dem Hintergrund der Klimakrise und notwendiger Transformationserfordernisse innerhalb aller raumprägenden Sektoren widmen sie sich der aktuellen Rechtslage und zukünftigen Adaptionsspielräumen in Bezug auf die Eigentumsrechte im Bereich des Katastrophenmanagements, der Bodenbeschaffung, des Industriewandels und der Denkmalpflege sowie der Renaturierung. Dragana Damjanovic ist seit März 2025 Professorin für Verwaltungsrecht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Von 2020 bis 2025 leitete sie den Forschungsbereich Rechtswissenschaften des Instituts für Raumplanung an der TU Wien.Florian Gehr hat das Bachelorstudium Sozialgeographie absolviert und interessiert sich für Themen im Bereich Wohnen und Housing. Er studiert im Master-Studiengang Raumplanung an der TU Wien. (Gruppe Bodenbeschaffung)Jona Elisa Gruse studiert im Master-Studiengang Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien. (Gruppe Denkmalschutz)Paul Hahnenkamp ist Post-Doc am Forschungsbereich Rechtswissenschaften des Instituts für Raumplanung an der TU Wien und forscht vor allem zu Eigentumsgrundrechten.Sultan Ondrus studiert im Master-Studiengang Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien. (Gruppe Katastrophenmanagement)Maria Stetter studiert im Master-Studiengang Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien. (Gruppe Renaturierung)Bianca Luca Tacha studiert im Master-Studiengang Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien. (Gruppe Industriewandel)Infos zum PodcastDer Podcast ZUKUNFT STADT ist ein Projekt der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Produziert wird dieser in einer Kooperation des future.lab mit dem Forschungsbereich Örtliche Raumplanung der TU Wien.Konzept: Dragana Damjanovic, Paul Hahnenkamp Produktion, Audio und Schnitt: Lukas Bast, Larissa Benk und Lisa-Marie KramerIntro Musik: Jakob Kotal














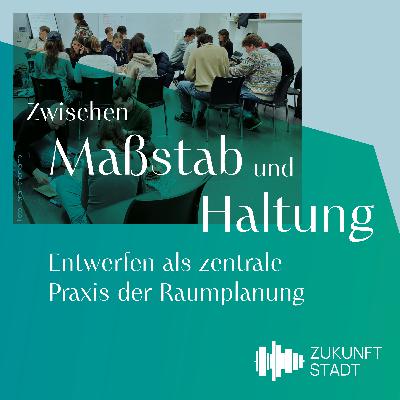
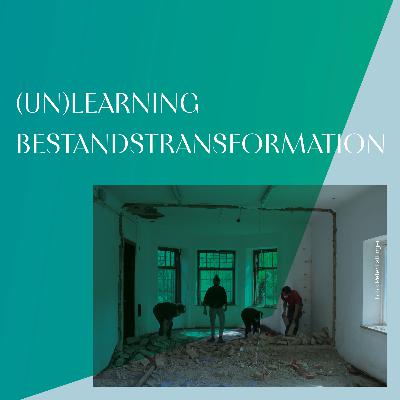


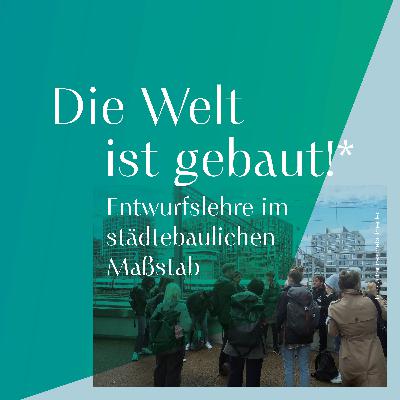
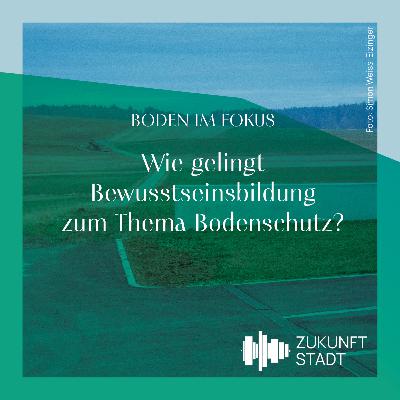
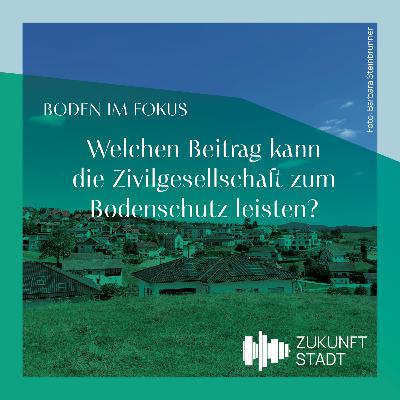
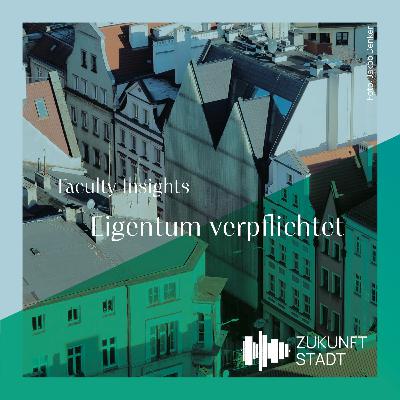



Total einverstanden – zu verstehen, wie Licht und Bewegung zusammenarbeiten, ist wirklich der Schlüssel zur kreativen Fotografie. Ich hab früher ständig damit gekämpft, Bewegung scharf einzufangen, bis ich diesen super verständlichen Artikel über Verschlusszeit auf dem https://luminarneo.de/blog/verschlusszeit-kamera gefunden hab. Da wird alles so klar und visuell erklärt – endlich hab ich kapiert, warum meine Action-Shots immer verwischt waren 😅. Jetzt spiel ich mit langen Belichtungen rum und hab das Gefühl, ich male mit Licht. Technik kann echt Spaß machen!