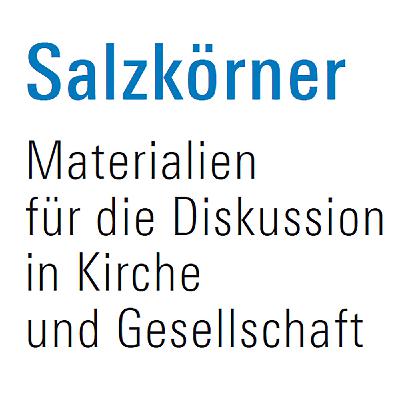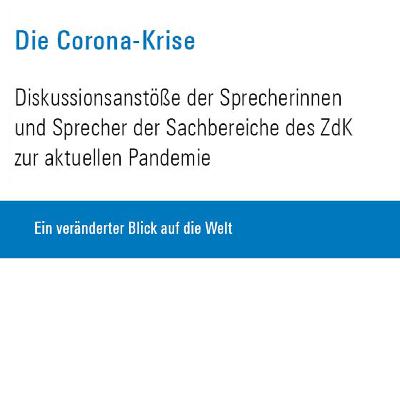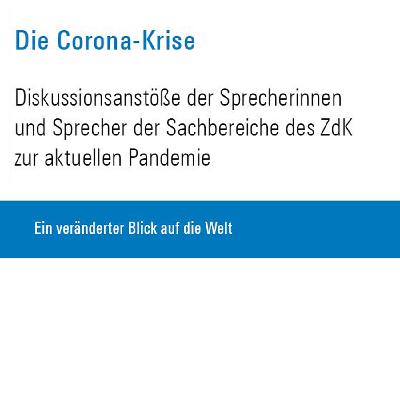Mit dem Kölner Pfarrer Franz Meurer über Ökumene, das Hövi-Kinderland, Glaube, Macht und Corona: „Wir machen für die Pänz, was irgend geht!“ -
Description
Seit 1992 ist Franz Meurer Pfarrer der katholischen
Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth in den Kölner Stadtteilen
Vingst und Höhenberg, die als „Problemviertel“ gelten: Dort leben rund
23.000 Menschen, von denen knapp 4.000 Sozialhilfe erhalten; jeder
Dritte ist Ausländer. Meurer initiierte zahlreiche Aktivitäten, von
einer Kleiderkammer und einer Essensausgabe bis zu Ferienfreizeiten für
630 Kinder – „HöVi-Land“ genannt. Er berichtet, wie die Ferienfreizeit
trotz Corona stattfinden konnte.
Es sollte die 27. Auflage unsere Kinderstadt HöVi-Land in den
Sommerferien sein. Für die „Pänz“, wie Kinder in Köln heißen, ist sie
das Highlight des Jahres. Ein kleines Mädchen brachte es für das
ARD-Morgenmagazin genial auf den Punkt, als es auf die Frage der
Reporterin, was denn am schönsten sei, antwortete: „Dass wir hier
zusammenhalten – und all die anderen Dinge.“In der Tat ist es der
Zusammenhalt, der das HöVi-Land auszeichnet. Der macht Ausflüge,
Schwimmen, Basteln oder gemeinsam Kochen noch mal so schön.
Die jugendlichen Leiterinnen und Leiter, die jedes Jahr eine
intensive Ausbildung erfahren, sind Vorbilder für die Kinder. Die
Abschiedstränen am letzten Tag der Ferienfreizeit beweisen es. Als
zusätzliches Dankeschön erhält jede/r ein T-Shirt mit dem jeweiligen
Motto. Heiß begehrte Sammlerobjekte. Ebenso das Armband, das jedes Kind
zu Beginn erhält. Eine Jugendliche trägt mittlerweile elf
HöVi-Land-Bänder am Handgelenk.
Die Kinderstadt ist keine Kinderbespaßung für drei Wochen, sondern
der real gewordene Traum eines solidarischen Gemeinwesens. Neben den
jugendlichen Gruppenleiterinnen der 30 Gruppen engagieren sich auch rund
300 Erwachsene. Natürlich ist alles ökumenisch. Und demokratisch. Für
alle und mit allen Menschen guten Willens.
Mit Corona geriet alles ins Wanken.
Doch der wöchentlich sich treffende Pfarrgemeinderat entschied: „Wir
machen für die Pänz, was irgend geht!“ Und so haben wir statt einer
Kinderstadt ein Kinderdorf eröffnet. Leider konnten statt 630 Kindern,
wie bisher, nur 210 teilnehmen und auch nur eine Woche statt drei. Die
Gruppen mussten auf Abstand zueinander bleiben. Jeweils zehn Kinder
waren in einer Gruppe, dazu drei Leiterinnen und Leiter. Jedem Kind
mussten im geschlossenen Raum fünf Quadratmeter zur Verfügung stehen.
Bei Aktivitäten draußen waren es zehn. Mittagessen ging nur jeweils in
der kleinen Gruppe. Das Essen kam nicht von der Zeltküche, die immer für
900 Personen gekocht hat, sondern wegen der strengen Hygieneregeln von
einem Caterer.
Der Kontakt zu den Kindern, die nicht mitkommen konnten, wurde über
Bildschirm gehalten. Junge Menschen hatten ein Fernsehstudio
eingerichtet, von dem aus Gesang, Sketche und morgendlicher Frühsport
übertragen wurden.
Besonders schön fand ich, dass etliche besser gestellte Familien auf
die Teilnahme ihrer Kinder verzichteten, damit ärmere wenigstens eine
schöne Ferienwoche erleben konnte. Das ist die Solidarität, die unseren
Stadtteil zusammenhält.