Discover Medien - Cross und Quer
Medien - Cross und Quer
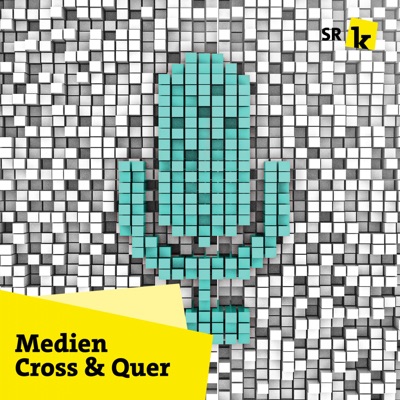
Medien - Cross und Quer
Author: SR
Subscribed: 75Played: 1,851Subscribe
Share
© SR
Description
Die Moderatorinnen und Moderatoren informieren, diskutieren und räsonieren jede Woche über neue Trends und kontroverse Themen aus der großen weiten Welt der Medien. Immer zu zweit, immer voller Meinungsfreude und immer auch mit fundierten und gründlich recherchierten Fakten. Gespräche mit Experten und Expertinnen, Umfragen unter Nutzerinnen und Nutzern und Statements aus der Medienbranche können Probleme benennen und Argumente untermauern. Zum Team des Formats gehören Katrin Aue, Thomas Bimesdörfer, Florian Mayer, Michael Meyer, Kai Schmieding und Sabine Wachs.
313 Episodes
Reverse
Für fast zwei Wochen ist die Weltklimakonferenz COP 30 im brasilianischen Belém ein internationaler Treffpunkt für Politik, Wissenschaft, Umweltverbände und Lobbygruppen. Entsprechend groß ist auch das Interesse der Medien. Aber bekommt dieses Treffen auch die öffentliche Aufmerksamkeit, die sich die Veranstalter für ihr Thema erhoffen? Oder sind Großveranstaltungen dieser Art inzwischen zu Ritualen erstarrt? Ist das das Ringen um einzelne Formulierungen in Abschlussverklärungen vielleicht einfach nicht spannend genug, um den Weg in die Schlagzeilen zu finden. Bekommt eine undiplomatische Äußerung von Kanzler Merz über das Gastgeberland deshalb mehr journalistische Bedeutung als das komplexe Thema Klima? Darüber sprechen Thomas Bimesdörfer und Stefan Eising mit Janina Schreiber aus der ARD Klimaredaktion, zum Zeitpunkt der Aufnahme Korrespondentin in Belém.
Die Netflix-Dokumentation "BABO" über den Deutschrapper Haftbefehl ist ein Streaming-Erfolg: Über 4 Millionen Abrufe in der ersten Woche, Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gleichzeitig sorgt sie für einen seltenen popkulturellen Moment – sogar ein 50 Jahre altes Lied von Reinhard Mey steigt durch eine Szene in der Doku wieder in die Charts ein.Darüber sprechen Katja Hackmann und Christoph Borgans mit dem Dokumentarfilmer Thomas Schadt. Was macht die Produktion so erfolgreich? Liegt es an der Berühmtheit des Rappers, seiner ungewohnten Verletzlichkeit oder an der Erzählweise bzw. Filmsprache?
Jahrelang verzeichneten die Social Media-Netzwerke wie facebook, Instagram, TikToK, X usw. stark steigende Nutzungszahlen, was sich auch in steigenden Gewinnen ausdrückte. Doch nun scheint sich ein Trend durchzusetzen, der den Silicon Valley-Konzernen nicht schmecken dürfte: Menschen ziehen sich von den Plattformen zurück. Laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts GWI verringert sich weltweit die Zeit, die Menschen mit Social Media verbringen. Interessanterweise vor allem bei Leuten unter 30. Kann das eine langfristige Entwicklung sein?Das fragen Katrin Aue und Michael Meyer den Journalisten Simon Berlin vom Socialmediawatchblog.
Sie heißen Substack oder Steady und sie sind Bühnen, Plattformen für Journalismus außerhalb der Verlagshäuser und Rundfunkanstalten. In den USA sind bereits große Namen und bekannte Edelfedern auf eigene Rechnung unterwegs. Ein typisches Beispiel ist der frühere Kolumnist der New York Times Paul Krugman. Auch in Deutschland gewinnt diese Art der Verbreitung publizistischer Inhalte erkennbar an Bedeutung. Was macht redaktionslose Plattformen so attraktiv für Journalistinnen und Journalisten? Darüber sprechen Thomas Bimesdörfer und Christoph Borgans mit Nils Minkmar, langjähriger Redakteur bei großen deutschen Printmedien, jetzt freier Autor für die Süddeutsche Zeitung und nicht zuletzt unabhängiger Blogger und Podcaster.
Junge Menschen lesen nicht mehr, heißt es oft. Wer sich in sozialen Medien umschaut, der weiß: Das stimmt nicht. Millionen teilen unter dem Hashtag BookTok ihre Leseeindrücke, weinen vor der Kamera über Romanfiguren oder werfen auch mal ein Buch wütend in die Ecke. Was macht diese Form der Literaturvermittlung so erfolgreich? Ist BookTok ein Grund zur Freude für alle Deutschlehrer? Oder geht es hier bloß um geschicktes Marketing? Christoph Borgans und Kai Schmieding sprechen mit der Medienforscherin Rieke Falkenstein, die sich mit der deutschsprachigen BookTok-Community beschäftigt hat.
Podcasts sind nah dran, persönlich, oft meinungsstark. Doch wie groß ist ihr tatsächlicher Einfluss auf die politische Meinungsbildung? Und welche Verantwortung tragen Hosts, die Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen – gerade in Zeiten von Fake News und Polarisierung? Während in den USA Podcasts längst gezielt für politische Kampagnen eingesetzt werden, wächst auch in Deutschland die Bedeutung des Formats als Meinungsmacher. Zwischen journalistischem Anspruch und persönlicher Haltung stellt sich die Frage: Wo verläuft die Grenze zwischen Information und Einflussnahme?Darüber reden Michael Meyer und Katja Hackmann und in dieser Folge mit dem SR-Korrespondenten Moritz Rödle aus dem ARD-Hauptstadtstudio, Teil des Podcasts "Berlin Code". Ein Gespräch über Nähe, Vertrauen und die Macht von Stimmen, die wir beim Wäscheaufhängen, Aufräumen oder auf dem Weg zur Arbeit hören.
Rund um den Tag der Deutschen Einheit wird immer gerne bilanziert: wie gut ist die Berichterstattung über die östlichen Bundesländer in den Medien? Die Antwort lautet dann oft: sie könnte besser, differenzierter sein. Und wie sieht es mit dem kleinen Land im deutschen Südwesten aus? Wenn Wälder brennen, wenn Öl auf dem Meer ausfließt oder Wasser ganze Landstriche überflutet, dann schlägt die Stunde des Saarlandes. Als Vergleichsgröße, zum Anschaulich machen der betroffenen Gebiete. In diesem Jahr ist die Landeshauptstadt Saarbrücken Gastgeber der Feierlichkeiten zur deutschen Einheit. Ein guter Anlass, um zu fragen: gibt es nicht auch in der überregionalen Saarlandberichterstattung Luft nach oben? Darüber reden Thomas Bimesdörfer und Michael Meyer mit dem langjährigen Nachrichtenredakteur des SR und Agenturkorrespondenten Michael Kuderna.
Seit Jahren wird der Umzug der Zeitungsbranche ins Digitale diskutiert. Viele, gerade kleinere Verlage tun sich damit schwer, denn im Internet sind deutlich weniger Werbegelder zu holen und auch die Leserschaft hängt oft noch am gedruckten Papier. Die taz versucht es nun als erste überregionale Tageszeitung: von Mitte Oktober an gibt es sie Montag bis Freitag nur noch digital, gedruckt und ausgeliefert wird nur noch am Wochenende. Was bedeutet das für die taz, aber auch für die gesamte Zeitungsbranche? Das fragen Thomas Bimesdörfer und Michael Meyer die Chefredakteurin der taz, Ulrike Winkelmann, und den Medienwissenschaftler und Gründer des VOCER- Instituts für Digitale Resilienz, Stephan Weichert.
Militärische Themen haben wieder Konjunktur in den deutschen Medien. Der Ukraine-Krieg hat das Territorium unseres östlichen Nachbarn Polen erreicht, dort haben Abfangjäger der Nato russische Drohnen abgeschossen. Die Wehrpflicht soll wieder gelten und viel Geld in die Rüstung gesteckt werden. Doch wie berichten Journalistinnen und Journalisten über das große Thema Verteidigung oder Wehrpolitik? Welche Schwerpunkte setzen sie, welche Begriffe müssen erklärt werden, wie sorgsam muss dabei die Sprache sein? Oder machen die Medien gar verbal mobil? Darüber sprechen Thomas Bimesdörfer und Stefan Eising mit Uli Hauck vom Saarländischen Rundfunk, er ist im ARD-Hauptstadtstudio Experte für Verteidigungspolitik.
Über viele Jahrzehnte war UKW die beste Möglichkeit, in hoher Qualität und verlässlich Radioprogramme zu senden. Inzwischen gilt die Ultrakurzwelle aber als veraltet und im Vergleich zu digitalen Übertragungswegen wie DAB auch als zu teuer. In ganz Europa wird daher das Ende von UKW zum Teil leidenschaftlich diskutiert. In der Schweiz wurde daraus so etwas wie ein Kulturkampf. Der dortige öffentlich – rechtliche Rundfunk hat sich bereits Ende 2025 von der UKW-Ausstrahlung verabschiedet. Aber damit auch von nicht wenigen Hörerinnen und Hörern. Jetzt versucht ein breites Bündnis, das endgültige amtliche Aus im nächsten Jahr noch zu verhindern. Unterstützt wird diese Initiative auch von den Schweizer Privatradios. Was ist medienpolitisch los bei den Eidgenossen und was könnte zum Beispiel die bundesdeutsche Medienpolitik aus der hitzigen Debatte um UKW lernen? Darüber sprechen Thomas Bimesdörfer und Kai Schmieding mit dem Schweizer Medienmanager und UKW-Lobbyisten Roger Schawinski.
Der deutsche Film und deutsche Serien sind immer mal wieder Grund für Klagen. Vieles sei nicht ansprechend oder erfolgreich genug, und doch eher etwas für spezielle Interessen. Doch nun soll einiges besser werden, es gibt einen Gesetzes-Entwurf für eine neue Form der Filmförderung, die unter anderem eine Investitionsverpflichtung zum Beispiel seitens der Streaming-Dienste vorsieht. Sprich: mehr deutsche Filme und Serien sollen entstehen. Aber hilft das? Das fragen Christoph Borgans und Michael Meyer Michelle Müntefering, die Geschäftsführerin der "Produktionsallianz", die 90 Prozent der deutschen Produktionslandschaft vertritt.
Pro7Sat1 wird wohl mehrheitlich von der FirmaMFE - "Media for Europe" übernommen. Dahinter stehen die Erben desBerlusconi-Konzerns in Italien. Was planen sie für den deutschen Fernsehmarkt und Was bedeutet diese Übernahme für die Programme? Etwa mehr billige Shows und politisch gefärbte Nachrichten, ähnlich den Verhältnissen in den USAmit FOX News und Co? Über die möglichen Folgen der Übernahme sprechen Michael Meyer undThomas Bimesdörfer mit dem ARD - Italien-Korrespondenten Andreas Strobel.
Es ist ein gängiges Klischee: Gamer sind wenig politisch interessiert und verbringen viele Stunden mit teilweise problematischen Games. Eine gerade erschienene Studie der Bertelsmann- Stiftung widerlegt dieses Klischee jedoch: Selbst Intensiv-Spieler sind politisch interessiert, vernetzen sich, beteiligen sich an Unterschriften-Aktionen oder Bürgerbewegungen. Auch vertrauen sie der Demokratie in hohem Maße. Also alles in Ordnung bei den Gamern? Das fragen Michael Meyer und Kai Schmieding den Autor der Bertelsmann-Studie Joachim Rother.
Wer Kinder hat, kennt es: Auch sie sind vom Internet fasziniert, wollen zocken, Videos gucken, sich austauschen. Fachleute raten: Für Kinder bis 3 Jahren lieber gar keine Bildschirmzeit, danach nur unter Aufsicht oder auf Plattformen, die man gut kontrollieren kann. Aber gibt's die wirklich? YouTube Kids gilt als eine App, die verhältnismäßig wenig Gefahren birgt. Aber auch dort finden sich verstörende Videos. Katrin Aue und Michael Meyer schauen sich gemeinsam mit der SR-Social-Media-Redakteurin Laura Erbe in der Welt der Sozialen Medien nach Angeboten für Kinder um – und nach solchen, die lieber keine sein sollten.
Die einen nennen es Panikmache, für die anderen ist die Berichterstattung über den Klimawandel und die daraus folgenden Wetterbelastungen immer noch viel zu harmlos. Wie aktuell bei manchen politischen Themen geht auch hier ein klarer Spalt durch die Gesellschaft. Gibt es eine Chance, beim Thema Klima wieder zu einer Berichterstattung für alle zu kommen? Ohne erhobenen Zeigefinger, aber auch ohne Verharmlosung der meteorologischen Veränderungen? Wie gut ist der Klimajournalismus jetzt schon aufgestellt, was empfehlen Forschungsergebnisse? Darüber sprechen Katja Hackmann und Thomas Bimesdörfer mit der Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Ludwig - Maximilians - Universität München, Imke Hoppe.
Künstliche Intelligenz wird immer beliebter - Apps wie ChatGPT oder Perplexity werden gerne genutzt, wenn Leser und Leserinnen nach bestimmten Themen suchen. Die dahinter liegenden Quellen der Sender und Verlage werden jedoch immer weniger aufgesucht, so belegen es neue Zahlen.Welchen Zusammenhang gibt es hier und wie kann man das Problem lösen? Erodieren da Geschäftsmodelle oder sollte man lieber kooperieren, wie der Springer-Konzern es mit ChatGPT vorgemacht hat? Das fragen Christoph Borgans und Michael Meyer den CEO der Publistik-Plattform Steady, Sebastian Esser.
Die amerikanische Regierung kürzt die Mittel für den US-Auslandsrundfunk.Doch nicht erst seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine stellt sichheraus, dass ausländische Akteure wie Russland mit Desinformationskampagnenarbeiten. Westliche Sender wie die Deutsche Welle, oder auch die BBC oder RadioFrance International arbeiten noch gegen die Desinformation an. Doch wie einflussreich sind diese Sender? Wie erfolgversprechend ist es, überhaupt, noch Auslandsrundfunk zu veranstalten? Und was kann man möglicherweise verbessern? Das fragen Michael Meyer und Thomas Bimesdörfer die Berliner Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Carola Richter.
In der Schweiz läuft die Fußball-EM der Frauen. Noch vor einigen Jahren hätte medial kaum ein Hahn danach gekräht. Aber im Jahr 2025 übertragen ARD und ZDF alle 31 Spiele live, im Hauptprogramm und im Livestream, mit beachtlichen Quotenerfolgen. Andererseits: andere Medien behandeln den Frauen-Fußball deutlich zurückhaltender. Auf kicker.de z.B. muss man schon etwas suchen, um einen Artikel über das Turnier in der Schweiz zu finden. Was ist das richtige Maß? Und was fällt inhaltlich auf bei der Berichterstattung über den Frauen-Fußball? Das besprechen Katrin Aue und Stefan Eising mit Marcus Bölz, Professor für Sportkommunikation an der Fachhochschule des Mittelstands FHM Berlin.
Friedrich Merz als Eisbärjäger und Robbenschlächter in Kanada? Mit Hilfe von KI versuchen russische Quellen, den Bundeskanzler vor allem im eigenen Land zu diskreditieren. Verdächtigt wird eine kremlnahe Propaganda-Gruppe mit dem Namen "Storm 1516". Sie hatte es auch schon auf die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und den ehemaligen Wirtschaftsminister Robert Habeck abgesehen. Aber droht jetzt eine neue Dimension der Falschmeldungen? Was genau wollen die russischen Propagandaportale erreichen? Und werden ihre Methoden mit Hilfe der künstlichen Intelligenz immer raffinierter? Steht eine neue russische Propagandaoffensive bevor? Darüber sprechen Katja Hackmann und Thomas Bimesdörfer mit Anton Himmelspach, er ist Redakteur und Geschäftsführer beim unabhängigen Onlinemagazin "dekoder".
Wer heute eine Reportage oder Doku schaut, bekommt es oft mit dem Reportervor der Kamera zu tun: Er oder sie erklären dann, was bisher bekannt ist, wie man recherchiert, und was die möglichen Fallstricke sind. Gerade junge Formate, wie "Strg F”oder "Vollbild” arbeiten so. Und auch Sendungen für Ältere setzen immer öfter den Reporter in Szene, dann menschelt es auch bei den eher abstrakten Themen. Aber ist das sinnvoll, erhöht das die Glaubwürdigkeit oder ist das pure Eitelkeit? Das fragen Michael Meyer und Kai Schmieding den Medienwissenschaftler Janis Brinkmann, der für die Otto-Brenner-Stiftung die Reportageformate untersucht hat.





