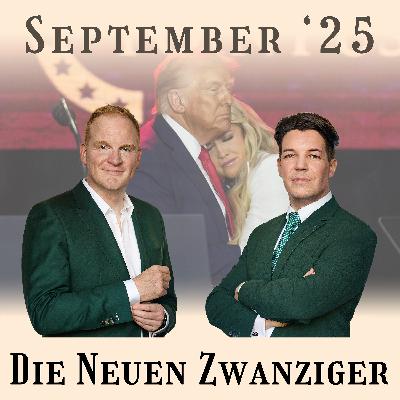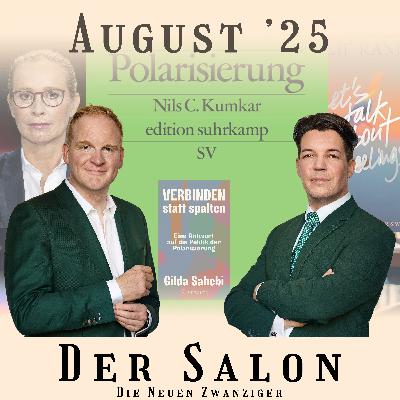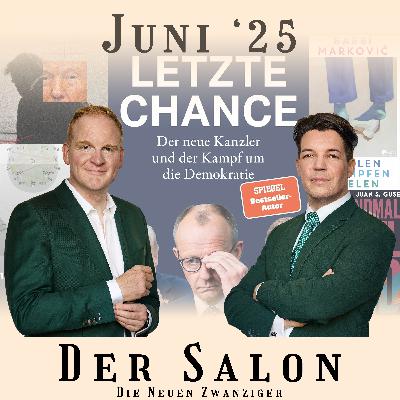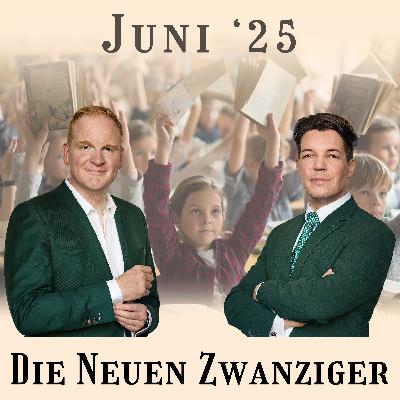Prechts Angststillstand, Das gute Übel, Happiness Gap, Social Media, Goldrausch, Peter Thiels Vorlesungen, Nobelpreis
Description
Alles hören
Komm' in den Salon. Es gibt ihn via Webplayer & RSS-Feed (zum Hören im Podcatcher deiner Wahl, auch bei Apple Podcasts und Spotify). Wenn du Salon-Stürmer bist, lade weitere Hörer von der [Gästeliste]
00:00:00 Vor dem Salon
Die einleitende Diskussion widmet sich einer breiten Palette aktueller Debatten, beginnend mit Richard David Prechts neuem Buch „Angststillstand". Es wird die zentrale Frage aufgeworfen, ob die Gesellschaft unter einer zunehmenden Angst leidet, die freie Meinungsäußerung einschränkt, oder ob im Gegenteil jeder ungefiltert seine Meinung im Internet verbreitet. Anschließend wird die Kritik am neuen Album von Taylor Swift und die Rolle von Social-Media-Influencern wie Rezo bei der Abwehr von Kunstkritik thematisiert, was in eine grundsätzliche Debatte über den Wert und die Funktion von Kritik in der Öffentlichkeit mündet. Am Beispiel der Kontroverse um die Autorin Caroline Wahl wird die Tendenz kritisiert, berechtigte Kritik an Kunst als persönlichen Angriff oder als strukturelles Problem des Literaturbetriebs umzudeuten, wobei ein historischer Rückgriff auf die polemischen Auseinandersetzungen von Marcel Reich-Ranicki die veränderten Diskursnormen verdeutlicht.
00:43:48 Wikipedia-Aufklärung
In diesem Kapitel erfolgt eine Richtigstellung zum sogenannten „Pillenknick", dem Geburtenrückgang in Westdeutschland. Basierend auf einem Wikipedia-Artikel wird dargelegt, dass die Anti-Baby-Pille zwar bereits 1961 eingeführt wurde, ihre gesellschaftliche Wirkung sich aber erst Anfang der 1970er Jahre entfaltete. Gründe für die Verzögerung waren die anfänglich restriktive Verschreibungspraxis der Ärzte, der Contergan-Skandal, der das Vertrauen in die Arzneimittelsicherheit erschütterte, sowie die Pillen-Enzyklika des Papstes. Es wird argumentiert, dass der entscheidende Faktor für den Geburtenrückgang weniger die Pille selbst als vielmehr ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel war, der durch Bildungs- und Berufschancen für Frauen sowie eine allgemeine sexuelle Liberalisierung angetrieben wurde.
Wichtige Erwähnungen: Club of Rome, Rainer Hank.
Schlüsselfrage: Was war der wahre Auslöser für den Geburtenrückgang in den 1970er Jahren – die Pille oder ein Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein?
00:49:04 Perspektivwechsel zu Trump
Dieser Abschnitt thematisiert den abrupten Wandel in der deutschen Medienberichterstattung über Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Es wird die Beobachtung geschildert, dass die öffentliche Meinung, die Netanyahu lange Zeit eine freie Hand in seiner Politik zugestand, plötzlich umschwenkte und Trump als denjenigen darstellte, der den israelischen Premierminister erfolgreich zügelt und diszipliniert. Dieses Phänomen wird als beispielhaft für einen „Cursor-Journalismus" kritisiert, der seine Positionen je nach politischer Großwetterlage opportunistisch anpasst und eine erstaunliche Inkonsistenz in der Haltung offenbart. Der schnelle und unkommentierte Perspektivwechsel wird als bemerkenswert und staunenerregend beschrieben.
Wichtige Erwähnungen: Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Mathias Döpfner.
Schlüsselfrage: Wie lässt sich der plötzliche Wandel in der medialen Darstellung von Trump und Netanyahu erklären?
00:57:35 Termine von Wolfgang und Stefan
Stefan kündigt einen Auftritt in Jena für den 21. Oktober an. Wolfgang verweist auf seine Termine am 27. Oktober in Berlin sowie auf weitere Veranstaltungen im November in Essen und Prag. Des Weiteren wird ein gemeinsamer Auftritt im Filmmuseum in Düsseldorf zum Thema Künstliche Intelligenz angekündigt, der aufgezeichnet und für Salon-Abonnenten zur Verfügung gestellt wird.
00:58:31 Salon-Hinweise
Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, den Salon zu abonnieren, um Zugang zu den ausführlichen Diskussionen zu erhalten. Besonders hervorgehoben wird die kommende, rund zweistündige Analyse des Buches „Angststillstand" von Richard David Precht. Ein Abonnement ermöglicht zudem den Zugriff auf das gesamte Archiv vergangener Episoden sowie auf die Aufzeichnungen der fünf jährlichen Live-Salons.
01:00:03 Archiv: neuezwanziger.de/salon
Es wird das neue, durchsuchbare Salon-Archiv auf der Webseite vorgestellt, das alle bisherigen Episoden mit detaillierten Kapitelmarken auflistet. Über eine Suchfunktion können Hörer gezielt nach besprochenen Themen, Autoren oder Begriffen suchen. Gleichzeitig wird auf die technische Herausforderung hingewiesen, das noch umfangreichere Archiv des Haupt-Podcasts mittels KI durchsuchbar zu machen, und es ergeht ein Aufruf für spezifische technische Hilfe bei diesem Projekt.
01:01:01 Richard David Precht: Angststillstand
Die ausführliche Diskussion von Richard David Prechts Buch „Angststillstand" beginnt mit der kritischen Analyse seiner Fundamentalkritik: der Diskrepanz zwischen der objektiv-rechtlichen und der subjektiv empfundenen Meinungsfreiheit, die laut Allensbach-Umfragen drastisch schwindet. Es wird der zentrale Widerspruch des Buches herausgearbeitet, der zwischen der These einer verängstigten Gesellschaft und dem Phänomen des ungehemmten Meinungsäußerns im Internet oszilliert. Die Diskussion kritisiert Prechts sozioökonomische Analyse einer „Bedarfsweckungsgesellschaft" als realitätsfern für die Mehrheit der Bevölkerung und hinterfragt seine Metapher des „Axolotl" für eine infantile Gesellschaft. Positiv hervorgehoben wird hingegen die Einführung der „drinnen-draußen-Arena" als mediale Meta-Ebene zu Steffen Maus' „Triggerpunkten", die den Kampf um Sichtbarkeit und Anerkennung beschreibt. Scharf kritisiert wird hingegen die pauschale Zuweisung von Diskursverengung an eine vermeintlich hegemoniale „woke Linke" sowie der historisch unhaltbare Vergleich von Shitstorms mit Pogromen.
Wichtige Erwähnungen: Institut für Demoskopie Allensbach, Richard Traunmüller, Nancy Faeser, Harald Welzer, Eva Illouz, Steffen Mau, Thilo Mischke, Nemi El-Hasan, Sarah Lee Heinrich, Karl May (Winnetou), Claudia Roth.
Schlüsselfrage: Beruht der von Precht diagnostizierte „Angststillstand" auf einer realen, gefühlten Bedrohung der Meinungsfreiheit oder auf einer verzerrten Wahrnehmung medialer Phänomene, die die ökonomische Realität der meisten Menschen ausblendet?
03:14:40 Precht in 1 Minute
Die abschließende Bewertung von Prechts Buch fällt ambivalent aus. Wolfgang würdigt die treffende Analyse der Verengung des Meinungskorridors, des Anpassungsdrucks im öffentlichen Diskurs und des „Cursor-Journalismus". Er kritisiert jedoch die unpräzise und überzogene Fokussierung auf „woke Kulturkämpfe" und eine mangelhafte ökonomische Fundierung. Stefan lobt den Ansatz, den „Hegemon" der Meinungsbildung zu untersuchen, bemängelt aber die argumentative Grundlage des Buches als dessen „Achillesferse". Er fordert eine Auseinandersetzung, die stärker die tatsächliche Mediennutzung der Bevölkerung berücksichtigt und weniger auf elitäre Kulturphänomene fixiert ist.
03:16:45 Samanta Schweblin: Das gute Übel
Wolfgang stellt den Erzählband „Das gute Übel" der argentinischen Autorin Samanta Schweblin vor, der bei Suhrkamp erschienen ist. Die Geschichten werden als im Realismus verhaftet, aber durch subtile, unheimliche und magische Elemente verschoben beschrieben. Anhand zweier Beispiele wird Schweblins Stil verdeutlicht: In „Ein fabelhaftes Tier" wird eine Frau von einer sterbenden Freundin gebeten, eine Erinnerung an deren verstorbenen Sohn zu rekonstruieren. In „Das Auge in der Kehle" erzählt ein Kind, wie es durch das Verschlucken einer Batterie die Fähigkeit zu sprechen verliert, was als Metapher für unausgesprochene Konflikte innerhalb der Familie dient. Gelobt werden Schweblins präzise Prosa, ihre Beobachtungsgabe für die Rätselhaftigkeit menschlicher Beziehungen und die Fähigkeit, das Alltägliche ins Fantastische zu überführen.
Wichtige Erwähnungen: Marianne Gareis (Übersetzerin), James Joyce (Ulysses), Don DeLillo.
Schlüsselfrage: Wie gelingt es Samanta Schweblin, durch die Verschiebung alltäglicher Realitäten ins Unheimliche und Magische, tiefere Wahrheiten über menschliche Beziehungen, Erinnerung und Schicksal aufzudecken?
03:27:38 Nate Silver: What explains the liberal-conservative happiness gap?
Basierend auf einem Artikel von Nate Silver wird die statistisch signifikante „Glückslücke" zwischen Liberalen und Konservativen in den USA erörtert. Die Daten zeigen, dass Konservative über alle Einkommens- und Altersgruppen hinweg durchweg höhere Zufriedenheitswerte angeben – so sehr, dass einkommensschwache Konservative sich als ebenso glücklich einschätzen wie einkommensstarke Liberale. Als mögliche Erklärungen werden diskutiert, dass Konservative durch traditionelle Anker wie Familie und Religion eine größere Resilienz besitzen, während Liberale ihre Unzufriedenheit performativ als Ausdruck der Solidarität mit Benachteiligten äußern. Eine weitere These ist, dass die gestiegenen Erwartungen an Selbstverwirklichung, insbesondere bei jungen liberalen Frauen, trotz objektiv besserer Lebenschancen zu einem höheren Enttäuschungspotenzial führen.
Wichtige Erwähnungen: Nate Silver, Matt Yglesias, Paul Dolan (Happy Ever After), Hoss und Hopf.
Schlüsselfrage: Ist die Kluft in der Zufriedenheit zwischen Liberalen und Konservativen auf fundamentale weltanschauliche Unterschiede, performati