Discover BGB AT
BGB AT
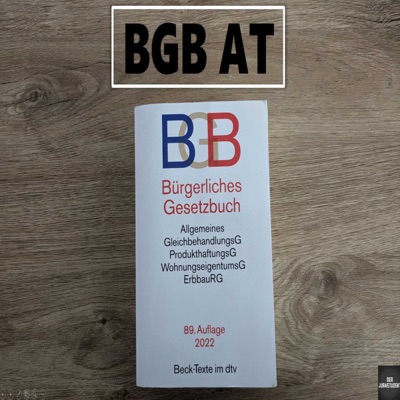
24 Episodes
Reverse
In diesem Video wird das BEWUSSTE Abweichen von subjektiv Gewolltem und objektiv Erklärtem nach den §§ 116, 118 behandelt. Den § 116 nennt man auch einen schlechten Scherz und der § 118 bezeichnet den guten Scherz. Auch wird die Relevanz in der Klausur angesprochen.Timestamps: 0:00 Intro 0:04 Übersicht Willensmängel 0:32 Beispiel 4:20 Beispiel 2 6:49 In der Klausur 9:38 Abgrenzung §§ 116, 118
In diesem Video besprechen wir die falsche Übermittlung durch einen Boten nach § 120 BGB. Dabei schauen wir uns sämtliche problematische Konstellationen an, z.B. ob § 120 bei Empfangsboten (analog) anzuwenden ist, das Problem der bewusst falschen Übermittlung und wie § 120 BGB bei Softwarefehlern zu handhaben ist.Timestamps: 0:00 Intro 0:08 Grundfall 3:20 Schema § 120 5:11 Übersicht Willensmängel 5:30 Computerfehler und § 120 8:45 Abwandlung 10:15 Keine Anwendung von § 120 (3 Fälle) 11:25 Bewusst falsche Übermittlung 15:35 Empfangsbote und § 120? 22:48 Übersicht Hilfspersonen Zugang 23:53 Abwandlung 25:57 Kontrollfragen
In diesem Video geht es um die subjektive und objektive Erheblichkeit des Irrtums nach § 119 I Hs. 2. Dies wird anhand von Beispielen dargestellt.Timestamps: 0:00 Intro 0:18 Übersicht Erheblichkeit 0:58 Beispiel subjektive Erheblichkeit 2:55 Beispiel objektive Erheblichkeit 3:55 2. Beispiel objektive Erheblichkeit 4:58 Kausalität auch bei § 119 II (Eigeschaftsirrtum) 5:12 Klausurhinweis
In diesem Video geht es um das Problem des externen Kalkulationsirrtums. Dieser wird anhand von Beispielen erklärt. Zunächst kommt ein kleiner Rückblick, dann geht es zum Grundfall und danach kommt eine Abwandlung.Timestamps: 0:00 Intro 0:07 Überblick und Rückblick 1:35 Grundfall Offener Kalkulationsirrtum 6:03 Abwandlung 7:40 Konstellationen
In diesem Video wird anhand von zahlreichen Beispielen der Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft einfach dargestellt. Der Fokus liegt auf der Klausur. So wird ein Schema erläutert und auch wie man auf dieses ohne Auswendiglernen kommen kann.Timestamps: 0:00 Intro 0:07 Motivirrtum 0:47 Übersicht Motivirrtum 1:42 Beispiel 1 2:34 Beispiel 2 4:05 Beispiel 3 4:49 Interner Kalkulationsirrtum 8:05 Anmerkung zum Gesetzestext 9:10 Schema § 119 II BGB 11:48 Eigenschaft 15:20 Preis/Wert als Eigenschaft? 20:13 Verkehrswesentlichkeit 23:23 Problem: Risiko bewusst eingehen 24:40 Problem: Berücksichtigung des vertraglichen Risikobereichs 26:45 Verhältnis zu den §§ 434 ff.
In diesem Video wird anhand von 2 Beispielen der Erklärungsirrtum als Anfechtungsgrund besprochen. Hierbei stelle ich ein Schema und die beste Vorgehensweise für die Klausur im Zivilrecht dar.Timestamps: 0:00 Intro 0:06 Beispiel 0:31 Lösung 7:08 Beispiel 2 7:33 Lösung
In diesem Video wird anhand von 2 Beispielen der Inhaltsirrtum als Anfechtungsgrund besprochen. Hierbei stelle ich ein Schema und die beste Vorgehensweise für die Klausur im Zivilrecht dar.Timestamps: 0:00 Intro 0:07 Beispiel 0:51 Lösung 6:10 Kompliziertes Beispiel 7:12 Lösung 9:08 Fehlendes Erklärungsbewusstsein anfechtbar?
Das wichtigste Video zum Anfechtungsrecht. Wir schauen uns die Willensmängel systematisch an und lernen das allgemeine Schema der Anfechtung an. Darüber hinaus werden grundlegende Gedanken zum Eigenschaftsirrtum § 119 II BGB, zum Inhaltsirrtum und zum Erklärungsirrtum vermittelt (§ 119 I).Timestamps: 0:00 Intro 0:14 Grundgedanke 1:56 Krasse Rechtsfolge 3:47 Systematik Willensmängel 6:55 Zeitpunkt des Willensmangels 9:09 Allgemeines Schema 11:23 Verortung 11:30 Anfechtungsgründe 13:15 Vorgehen in der Klausur 16:08 Weitere Anfechtungsgründe 17:25 Anfechtungserklärung
In diesem Video wird anhand eines Beispiels das BGB AT Problem der Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht dargestellt. Es wird ein Lösungsvorschlag für die Klausur unterbreitet und andere Ansichten werden auch erläutert.Timestamps: 0:00 Intro 0:07 Sachverhalt 0:43 Skizze Sachverhalt 1:36 Anwendung nur des Gesetzes 4:08 Die 2 Probleme bei der Anfechtung der ausgeübten Innenvollmacht 7:47 Problem 1: Anfechtungsgegner 8:38 Problem 2: Haftungskette 10:26 Eine mögliche Lösung 12:50 Darstellung der Lösung anhand der Skizze 19:18 Andere Ansichten 21:53 Vorgehen in der Klausur 23:37 Verständnis
In diesem Video wird anhand von 2 Beispielen und einer Übersicht die Problematik des Schweigens im Kontext der Rechtsgeschäftslehre behandelt.Timestamps: 0:00 Intro 0:08 Übersicht 2:26 Beispiel 2:58 Gegenbeispiel 3:36 Unterschied
Es wird die 4. Voraussetzung für die Stellvertretung nach § 164 I besprochen: Die Vertretungsmacht. Sowohl die Vollmacht als auch die gesetzlichen Vertretungsmachten werden behandelt. Die §§ 177 ff., der Vertreter ohne Vertretungsmacht, und der Missbrauch der Vertretungsmacht mit seinen 2 Fallgruppen, der Kollusion und der Evidenz, also das Können und Dürfen bzw. das Innen- und Außenverhältnis wird besprochen. Das schauen wir uns wie immer im Hinblick auf die Klausurlösung an.Timestamps: 0:00 Intro 0:15 Aufbau in der Klausur 1:59 Übersicht Vertretungsmacht 2:12 Vertretungsmacht durch Gesetz 4:03 Vollmacht 6:54 Erlöschen der Vollmacht 8:32 Auftragsverhältnis und Vollmacht (§ 674) 11:48 Erlöschen der Vollmacht weiter 13:14 Form der Vollmacht und Ausnahmen 17:49 Umfang der Vertretungsmacht 18:34 Vertreter ohne Vertretungsmacht (§ 177 ff.) 26:24 Missbrauch der Vertretungsmacht 28:28 Innen- und Außenverhältnis 30:17 Können vs. Dürfen 32:53 Kollusion und Evidenz 38:13 Bote ohne Botenmacht 40:02 Kontrollfragen
In diesem Video wird anhand von einem Beispiel die Duldungsvollmacht und anhand eines weiteren Beispiels die Anscheinsvollmacht besprochen. Dabei wird der Fokus auf die optimale Prüfung in der Klausur gelegt.Timestamps: 0:00 Intro 0:06 Übersicht Vertretungsmacht 0:45 Prüfung in der Klausur 3:42 Unterscheidung zwischen Anscheins- und Duldungsvollmacht 5:00 Beispiel Duldungsvollmacht 5:51 Lösung 10:14 Beispiel Anscheinsvollmacht 10:49 Lösung
In diesem Video wird die Stellvertretung nach den §§ 164 ff. anhand von zahlreichen Beispielen dargestellt. Es geht um das Offenkundigkeitsprinzip, die Abgrenzung zwischen Bote und Vertreter, dem Geschäft für den den es angeht und dem Handeln unter fremden Namen und unter falschem Namen. In dem nächsten Video schauen wir uns die Vertretungsmacht genauer an.Timestamps: 0:00 Intro 0:03 Überblick 1:53 Voraussetzungen der Stellvertretung 2:15 Rechtsfolge & Beispiele 3:57 Zulässigkeit der Stellvertretung 5:37 Eigene Willenserklärung 16:13 Passive Stellvertretung 19:27 In fremden Namen / Offenkundigkeitsprinzip 20:49 Unternehmensbezogenes Geschäft & Beispiel 24:22 Geschäft für den, den es angeht 28:45 Offenes Geschäft für den, den es angeht 30:15 Identitätstäuschung und Namenstäuschung 35:32 § 164 II BGB 40:56 Überblick "mit Vertretungsmacht" 43:06 Wie "mit Vertretungsmacht" in der Klausur prüfen? 43:43 Kontrollfragen
In diesem Video werden anhand von Beispielen die §§ 145 ff. BGB erklärt. Mehr fällt mir auch nicht ein, was ich jetzt schreiben könnte.Timestamps:0:00 Intro0:05 3 Grundlagen1:11 Grundgedanke § 145 BGB3:06 Beispiel 17:15 Beispiel 211:22 § 149 BGB13:21 § 151 BGB & Beispiel14:12 Unterschied § 153 vs. § 130 II BGB
In diesem Video wird die klausurrelevante abhandengekommene Willenserklärung besprochen. Es handelt sich um ein Standardproblem im Zivilrecht bei der Wirksamkeit von Willenserklärungen, nicht beim Tatbestand der Willenserklärung! Dies wird anhand von Beispielen einfach erklärt.Timestamps:0:00 Intro0:06 Beispiel1:13 Lösung1:44 Kein Problem des Tatbestandes der WE!2:28 Übersichtund Verortung des Problems3:13 Ansichten - Übersicht4:09 Meinungsstreit Darstellung6:35 Streitentscheid
In diesem Video geht es um den Erklärungsboten, Empfangsboten und Empfangsvertreter. Diese werden anhand einer Übersicht und Beispielen dargestellt.Timestamps:0:00 Intro0:10 Übersicht0:27 Empfangsvertreter2:06 Empfangsbote4:47 Erklärungsbote6:48 Beispiel
§ 130 BGB regelt nur den Zugang unter Abwesenden. Wann wird eine Willenserklärung also wirksam, wenn 2 Personen sich gegenüberstehen oder telefonieren? Das wird in diesem Video anhand von einem Beispiel besprochen.Timestamps:0:00 Intro0:17 Übersicht - Zugang bei Abwesenheit vs Anwesenheit1:14 Beispiel2:55 Problem: Zugang unter Anwesenden3:04 Strenge Vernehmungstheorie4:10 Eingeschränkte Vernehmungstheorie
In diesem Video wird alles klausurrelevante für den Fall besprochen, dass der Zugang nach § 130 vereitelt wird. Hier gibt es zwei Rechtsfolgen: Einmal die Zugangsfiktion und einmal die Rechtzeitigkeitsfiktion. Dies wird anhand von Beispielen besprochen.Timestamps:0:00 Intro0:04 Grundidee0:59 Übersicht über die Rechtsfolgen1:33 Zugangsfiktion1:54 Beispiel2:37 Lösung4:28 Zusammenfassung Zugangsfiktion4:54 Beispiel5:44 Lösung6:38 Zusammenfassung Rechtzeitigkeitsfiktion7:27 Zugangsfiktion vs Rechtzeitigkeitsfiktion8:41 Erklärender handelt böswillig10:05 Culpa in contrahendo (c.i.c.)11:03 Meme
In diesem Video wird die Auslegung nach dem hypothetischen Parteiwillen besprochen. Diese wird anhand von Beispielen erklärt. Ihr solltet hiervon mal gehört haben.Timestamps:0:00 Intro0:09 Grundfall0:49 Beispiel4:05 Beispiel 25:52 Zusammenfassung und bla bla
In diesem Video geht es weiter im BGB AT, wir besprechen die Wirksamekeit einer empfangsbedürtigen und einer nichtempfangsbedürftigen Willenserklärung. Dies wird anhand von vielen Beispielen erklärt und in ein Schema gepackt.Timestamps:0:00 Intro0:04 Übersicht1:17 Stadien einer nichtempfangsbedürftigen WE2:44 Wirksamkeit nichtempfangsbedürftige WE3:24 § 151 BGB (Entbehrlichkeit des Zugangs)6:15 Stadien einer empfangsbedürftigen WE9:48 Voraussetzungen/Schema14:37 Beispiel 117:14 Beispiel 217:41 Beispiel 3 (Zugang bei e-mail)19:17 Widerruf § 130 I 2 BGB und Beispiel24:09 Beispiele für empfangsbedürftige WE24:16 Kontrollfragen
Comments
 United States
United States


