Discover Volkswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
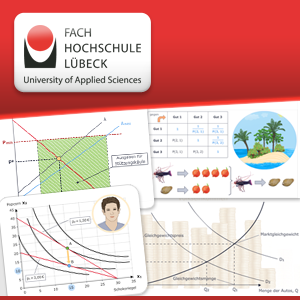
58 Episodes
Reverse
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Zwei unterschiedliche Koordinationsformen können prinzipiell die Lösung der Allokations- und Distributionsprobleme herbeiführen:
* dezentrale und wechselnde Tauschbeziehungen (Markt);
* zentrale Koordination durch Anweisungen in einer langfristigen festen Beziehung (Hierarchie).
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Der Gewinnmechanismus in einem offenen Markt bei Konkurrenz, zwingt also die einzelnen Anbieter zur Kosteneffizienz. Anbieter, die zu teuer produzieren, werden aus dem Markt gedrängt und durch Anbieter, die günstiger produzieren, ersetzt. Davon profitieren vor allem die Kunden. Dies gilt zumindest auf lange Sicht, da das Angebot dann tendenziell elastischer wird. Die nachfolgende Interaktion zeigt die Preisreaktion am Markt auf eine Ausweitung der Nachfrage. Auf (sehr) kurze Sicht ist das Angebot noch starr, langfristig dagegen vollständig elastisch. Je elastischer das Angebot ist, umso geringer fällt der Preisanstieg bei einem Anstieg der Nachfrage aus.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Die langfristige Kostenfunktion KL weist im Vergleich zu den kurzfristigen Kostenfunktionen KK folgende Eigenschaften auf:
Die TKlang-Kurve verläuft durch den Nullpunkt.
Die TKkurz-Kurven tangieren die TKL-Funktion dort, wo auch kurzfristig eine Minimalkostenkombination erreicht ist.
Die TKlang-Funktion verläuft immer unterhalb jeder TKkurz-Kurve.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Fischer und Chemieproduzenten konkurrieren in diesem Beispiel um die Verwendung des Sees. Können beide Parteien trotzdem in freien Verhandlungen zu einem Ergebnis kommen, das eine effiziente Nutzung der Ressource herbeiführt?
Ronald Coase hat gezeigt, dass dies im Prinzip möglich ist, wenn die Nutzungsrechte institutionell klar geregelt sind.Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Nutzungsrechte zu regeln:
Schadenshaftung: Die Fischer besitzen das Recht zur Nutzung des Gewässers und müssen bei einer Verschmutzung des Wassers durch die Chemiefabriken entschädigt werden.
Schädigungsrecht: Die Chemieproduzenten dürfen ihre Abwässer in den See leiten. Die Fischer besitzen allerdings die Möglichkeit, das Schädigungsrecht von den Chemiefabriken abzukaufen.
Diese Animation zeigt ihnen wie "Schadensrecht" im Idealfall zu einer optimalen Nutzung des Wassers führt.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Diese Animation zeigt, dass starre Auflagen eine ineffiziente Allokation der Schadstoffbelastung begünstigen. Diejenigen, die mit niedrigen Vermeidungskosten produzieren, haben nur einen geringen Anreiz zur Schadstoffreduktion, während vor allem diejenigen Produzenten mit hohen Vermeidungskosten die Emissionen reduzieren. Um diese Fehllenkung zu vermeiden, könnte der Staat die Mengenvorgaben den individuellen Grenzvermeidungskosten anpassen. Damit müsste aber die zuständige Behörde über betriebliches Insiderwissen verfügen. Den Angaben der Verursacher selbst sollte man schließlich nicht trauen, denn jeder von ihnen hätte den strategischen Anreiz, seine Kosten zu übertreiben. Sinnvoller ist es deshalb, Instrumente der Internalisierung einzusetzen, die einem effizienten Preismechanismus wieder auf die Beine verhelfen.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Man sieht, dass mit einer Besteuerung ebenso wie mit der Zertifikatslösung die „unsichtbare Hand des Marktes" auch bei Externalitäten eine effiziente Allokation herbeiführt. In der Praxis wird dies allerdings nur näherungsweise gelingen, denn das Informationsproblem zur Zielvorgabe einer effizienten Reduktion der Schäden bleibt bestehen. Handelbare Zertifikate haben dabei den Vorteil, unmittelbar ein Mengenziel zu verfolgen. Bei einer Steuer geschieht die Steuerung der Schädigungsmenge dagegen nur indirekt über den Steuersatz. Die Wahl des richtigen Steuersatzes erfordert dann aber die genaue Kenntnis der Preiselastizität der Nachfrage nach Verschmutzung. Außerdem besteht bei dem Einsatz von Umweltsteuern auch die Gefahr, dass diese unter fiskalischen Gesichtspunkten vorrangig als Einnahmequelle betrachtet werden, und dies die Bemessung des Steuersatzes beeinflusst. Da bei Zertifikaten die Preisbildung dem Markt überlassen wird, ist die ökologische Treffsicherheit der Zertifikatslösung besonders hoch, wenn es alleine um die Eingrenzung der Summe der Emissionen geht.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Wir wollen nun zeigen, dass die berechnete Grenzertragskurve dem Anstieg der Gesamtertragskurve entspricht.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Der Anstieg einer Indifferenzkurve gibt über die Tauschbereitschaft Auskunft. Je steiler die Indifferenzkurve ist, desto wichtiger ist dem Konsumenten Gut 1 im Verhältnis zu Gut 2; d.h. umso mehr von Gut 2 benötigt er als Kompensation für den Verlust einer Einheit von Gut 1, damit sein Nutzen unverändert bleibt.
Verlaufen die Indifferenzkurven erst steil (GS hoch) und werden dann mit Mehrkonsum von Gut 1 immer flacher (GS sinkt), dann bringt dies eine zunehmende Sättigungstendenz für Gut 1 zum Ausdruck. In die umgekehrte Richtung bedeutet dies natürlich auch eine Sättigungstendenz bei Gut 2. Statt über den sinkenden Grenznutzens eines Gutes (1. Gossensches Gesetz) lässt sich die zunehmende Sättigung beim Konsum somit auch durch die sinkende Grenzrate der Substitution darstellen.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Sven macht gerade eine harte Zeit durch. Sein monatliches Einkommen ist gesunken und daher stehen ihm jetzt nur noch 30 statt 60 Euro für sein Süßigkeitenbudget zur Verfügung. Die Preise sind unverändert geblieben. Wie wird Sven seine Nachfrage an die neue Situation anpassen?
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
(Übrigens: Dass Kunden kurz vor dem Bezahlen durch die Regale irren, um ihren Warenkorb optimal zu sortieren, lässt sich immer mal wieder beobachten -- auch bei VWL-Professoren.)
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Wir haben nun herausgefunden, welche Menge an Popcorn jeweils bei einem Preis von 1,50 € und 3 € von Sven (unter sonst unveränderten Bedingungen) konsumieren wird. Seine Nachfrage zu unterschiedlichen Preise kann man in ein Preis-Mengen-Diagramm eintragen. An den zwei soeben ermittelten Punkten lässt sich erkennen, dass Svens Reaktion auf Preisveränderungen dem „Gesetz der Nachfrage" gehorcht. Seine Popcorn-Nachfrage sinkt mit steigendem Preis. Die unten angedeutet Gerade durch die beiden hergeleiteten Preis-Mengen-Kombinationen ist aber nur eine grobe Annäherung an die tatsächliche Nachfragekurve. Um den Zusammenhang exakt darzustellen, müsste der Popcorn-Preis systematisch variiert werden, um alle dazu passenden Nachfragemengen von Sven zu erfassen. Wenn man auf diese Weise genügend viele Punkte in dem Diagramm sammelt, kann sich natürlich auch zeigen, dass die Nachfrage nichtlinear auf den Preis reagiert.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Die bei wechselseitiger Spezialisierung erreichte Produktion von 20 Äpfeln und 16 Langusten muss für Adam und Eva nicht immer die wünschenswerte Lösung sein. Vielleicht haben beide beschlossen, eine vegetarische Woche einzulegen. Dann sollten natürlich keine Langusten sondern nur Äpfel produziert werden. Es ist also notwendig, alle Produktionsmöglichkeiten auf der Insel herauszufinden. Die Animation zeigt Ihnen, wie sich eine Transformationslinie für Paradise Island bestimmen lässt.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Steuern sind bei Bürgern nicht sehr beliebt. Schließlich ist mit dieser staatlichen Zwangsabgabe keine direkte Gegenleistung für den Steuerzahler verbunden. Die meisten Steuern beziehen ihre Bemessungsgrundlage auf wirtschaftliche Aktivitäten an Märkten wie z.B. die Einkommensteuer, Umsatzsteuer oder die Besteuerung bestimmter Produkte.
Während der einzelne Steuerzahler seine individuelle Steuerbelastung an dem zu zahlenden Steuerbetrag bemisst, stellt aus volkswirtschaftlicher Sicht der Effizienzverlust durch die Verzerrung von Marktpreisen die eigentliche Belastung dar.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Steuerlehre im Online BWL Fernstudiengang
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
In dieser Animation sieht man anhand Stefans Beispiel, Steuern sind allgegenwärtig, die Liste ließe sich fast beliebig erweitern. Der Staat braucht Geld, um seine Ausgaben zu finanzieren. Steuern sind seine wichtigste Einnahmequelle. Kein Bürger und kein Unternehmen kann sich ihnen entziehen. Für Unternehmen ist die Kenntnis der Einzelsteuern wichtige Voraussetzung für das Treffen steueroptimaler Entscheidungen.
Arbeit muss sich lohnen, und wenn man einen höheren Lohn erhält, dann ist man auch bereit, mehr zu arbeiten. Stimmt das? Testen wir doch, wie Daniela auf eine Erhöhung des Lohnsatzes reagiert, wenn alles andere dabei unverändert bleibt.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Beides ist möglich: ein höherer Lohnsatz kann es ebenso lohnenswert machen, mehr zu arbeiten wie auch mehr Freizeit zu genießen.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
In dieser Animation wir der Einkommenseffekt und der Substitutionseffekt anhand eines Beispiels(Daniela) verdeutlicht.
Substitutionseffekt
Die ausschließliche Reaktion des Konsumenten auf die Änderung des relativen Preises eines Gutes wird als Substitutionseffekt bezeichnet. Er bemisst sich als die Änderung der Nachfrage, die sich ergibt, wenn der Konsument das verteuerte gegen das billiger gewordene Gut so austauscht, dass er sich dabei nicht „besser" oder „schlechter" fühlt, also der Nutzen unverändert bleibt.
Einkommenseffekt
Der Einkommenseffekt einer Preisänderung bezeichnet die ausschließliche Reaktion des Konsumenten auf die Kaufkraftveränderung des Einkommens. Er bemisst sich an der Nachfrageänderung, die dadurch ausgelöst wird, dass der Konsument sich mit der Kaufkraftsenkung (bzw. Kaufkrafterhöhung) ärmer (bzw. reicher) fühlt, da er nur noch einen niedrigeren (bzw. höheren) Nutzen erreichen kann.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Wie empfindlich reagiert das Arbeitsangebot tatsächlich auf Veränderungen des Lohnsatzes? Diese Frage kann man nur durch empirische Forschung klären. Es hat dazu zahlreiche Untersuchungen für unterschiedliche Länder und Berufe gegeben. Einen Überblick zu diesen Studien finden Sie bei Evers et al. (2005). Die statistischen Ergebnisse streuen zwar sehr breit, aber es lässt sich eine Tendenz erkennen:
- Bei einer 1-prozentigen Erhöhung des (realen) Lohnsatzes reichen die Reaktionen von einem Anstieg der angebotenen Arbeitszeit um 2,8% bis zu einem Rückgang von 0,25%.
- Frauen reagieren auf die gleiche Lohnsteigerung mit einer stärkeren Ausweitung ihres Arbeitsangebots als Männer. Ein Rückgang des Arbeitsangebots aufgrund eines höheren Lohnes ist bei Männern häufiger zu beobachten als bei Frauen.
- Auf einen Anstieg des gesamten Einkommens wird tendenziell mit einem Rückgang des Arbeitsangebots reagiert. Das heißt im Umkehrschluss, dass Freizeit kein inferiores Gut ist.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Das Budget und der Schokoladenpreis blieben unverändert, als sich das Popcorn verteuerte. Diese Feststellung betrifft aber nur die Bewertung in Euro. Für die ökonomische Entscheidung kommt es dagegen nicht auf den Geldpreis, sondern auf den relativen Preis eines Gutes an. Und nicht das nominale Einkommen in Euro ist entscheidend, sondern die Kaufkraft dieser Geldsumme, bestimmt wie „reich" man ist. Beide -- der relative Preis der Schokolade und das reale Einkommen -- haben sich aber mit der Verteuerung des Popcorns verändert. Damit gehen zwei unterschiedliche Effekte von einer Preisänderung auf die Nachfrage aus.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Stillschweigende Übereinkünfte bleiben zumeist instabil -- auch bei einer Tit-for-Tat-Strategie. Ein missverständliches Signal oder eine falsche Handlung und schon kann ein Preiskrieg die Folge sein. Oligopolistische Anbieter hegen daher oft den Wunsch nach Stabilität der Preise. Sie sind dafür sogar bereit, eventuelle Kostensenkungen oder einen Rückgang der Nachfrage nicht sofort in Preissenkungen weiterzugeben, weil eine solche Handlung von den Konkurrenten als „Aggression" gedeutet werden könnte und Vergeltung provozieren würde. Paul M. Sweezy (1939) stellte die Hypothese auf, dass in diesem Fall die Anbieter mit einer Preis-Absatz-Funktion planen, die einen Knick aufweist.
Diese Animation stammt aus dem Kurs Volkswirtschaftslehre im Online Fernstudiengang BWL.
Mehr Infos: http://oncampus.de/index.php?id=1250
Jeder Fischer auf diesem Markt plant sein Angebot als Mengenanpasser nach der „Preis = Grenzkosten"-Regel. Die für jeden Anbieter identischen Grenzkosten sollen linear mit dem Output steigen. Dann lässt sich das geplante Gesamtangebot am Markt als eine ansteigende Gerade darstellen, die ausdrückt, dass mit steigendem Preis auch die Angebotsmenge steigt.





