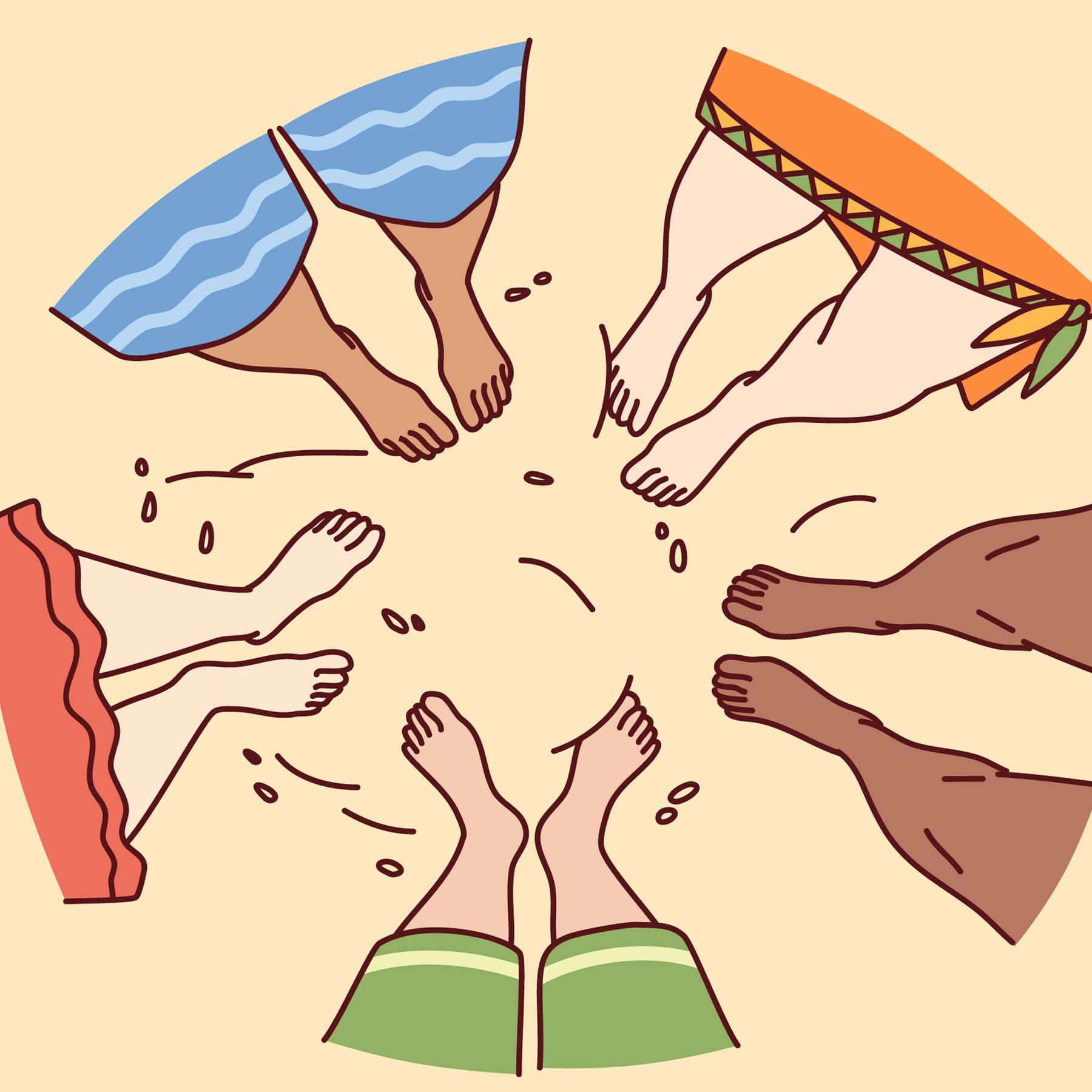Katzen als Helden - Von Baudelaire bis zu den Warrior Cats
Description
Sie lösen verzwickte Fälle in Krimis, schreiben Autobiographien, kämpfen als Fantasy-Krieger, schnurren erotisch in der Lyrik oder assistieren gar dem Teufel: Katzen. Eleganter und häufiger streunt kein anderes Tier durch die Weltliteratur. Warum sind ausgerechnet Katzen die prominenten "Helden" so vieler Geschichten?
Credits
Autor/in dieser Folge: Frank Halbach
Regie: Frank Halbach
Es sprachen: Laura Maire, Thomas Birnstiel
Redaktion: Katharina Hübel
Im Interview:
Dr. Jakob Christoph Heller, Literaturwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Nicht Mehr Mein Land - Geschichten über Migration, den Rechtsruck und die Gräben zwischen uns
Im Sommer 2015, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ist Host Ali stolz auf sein Land und seinen Namen. Aber schon im selben Jahr gibt es heftige Proteste gegen Flüchtlinge. Angela Merkel sagt daraufhin, wenn wir uns für Nothilfe entschuldigen müssen, "dann ist das nicht mein Land". Heute, zehn Jahre später, gilt Migration nicht mehr als Chance, sondern als Schimpfwort. Deshalb will Ali herausfinden: Was ist in den letzten zehn Jahren falsch gelaufen? Und er fragt sich: Ist das noch mein Land? https://1.ard.de/nicht-mehr-mein-land?cp=radiowissen
Linktipps:
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
SPRECHER
Es wird ihnen gehuldigt wie hier in den Versen der Gedichtsammlung „Die Blumen des Bösen“ aus dem Jahr 1857 von Charles Baudelaire, einem der bedeutendsten Lyriker der französischen Literatur – übersetzt von dem deutschen Dichter Stefan George - nicht weniger eigenwillig und provokant als Baudelaire. Beides Literaten, an denen sich die Geister schieden – Charaktereigenschaften, wie sie auch Katzen zugeschrieben werden. Wohl kein Zufall, dass sie Katzenfans waren.
Kaum ein Geschöpf hat so kontinuierlich seine Spuren in der Literaturgeschichte hinterlassen wie die Katze und das liegt nicht nur daran, dass dichtende Katzenbesitzer wie Michel de Montaigne, Charles Dickens, Mark Twain oder Ernest Hemingway ihren schnurrenden Fellgenossen eine Liebeserklärung machen wollten. Ihr Wesen und ihre Eigenschaften boten im Verlauf der Jahrhunderte gerade für intellektuell interessierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller eine besondere Projektionsfläche für geistesgeschichtliche Auseinandersetzung und philosophischen Diskurs – und für Provokationen verschiedenster Art.
MUSIK
SPRECHER
Katzen sind…
SPRECHERIN
Elegant, neugierig, anmutig, frech, klug, sanft, eigenwillig, genaue Beobachter, anschmiegsam und geheimnisvoll. Sie haben einen siebten Sinn – und sieben Leben. In manchen Kulturen. In anderen: gar neun.
MUSIK hoch
MUSIK ENDE + Geräusch Miau
SPRECHER
Dr. Jakob Christoph Heller, Literaturwissenschaftler an der Uni Halle-Wittenberg, hat sich ausführlich mit der Rolle der Katze in der Literatur auseinandergesetzt. Besonders faszinieren ihn die zwei Gesichter der Katze in der Kulturgeschichte:
01 O-Ton Heller (00:51 )
Also es fängt ja an im alten Ägypten mit der kultischen Verehrung der Katze, als diese Göttin Bastet mit Katzenkopf als Göttin der Fruchtbarkeit, dann aber auch die Göttin Sachmet (…), die dann wiederum, Wut repräsentiert. Also es gibt sozusagen schon kulturgeschichtlich so eine Art Doppelgestalt der Katze, die wahrscheinlich jeder Katzenhalter, jede Katzenhalterin kennt, als einerseits verspielt, schmusevoll, natürlich schön und irgendwie, dann auf der anderen Seite aber, eigenwillig, undurchschaubar, unerklärlich, beißt auch gerne mal oder kratzt in unerwarteten Momenten.
MUSIK
SPRECHERIN
Ja, in alten Zeiten wurden Katzen als Göttinnen verehrt – und das haben sie offensichtlich nicht vergessen.
SPRECHER
Während sie sich als literarische Helden erst entwickeln mussten.
In einer Fabel Äsops, entstanden im 6. Jahrhundert vor Christus, verliebt sich eine Katze in einen begehrenswerten jungen Mann. Sie fleht die Liebesgöttin Aphrodite an, sie in einen Menschen zu verwandeln. Die Göttin verleiht der Katze die Gestalt einer bezaubernden Frau. Schon wird geheiratet. Doch in der Hochzeitsnacht stellt Aphrodite die Katze auf die Probe: Sie lässt eine Maus durch das Gemach laufen. Da springt die junge Braut mit einem Satz aus dem Bett, schnappt sich blitzschnell und gekonnt die Maus und verschlingt sie. Umgehend verwandelt Aphrodite die Braut wieder zurück in eine Katze.
MUSIK ENDE
SPRECHERIN
Irgendwie steht die Katze am Anfang ihrer literarischen Karriere also auf einer Schwelle zwischen Wildheit und Zivilisation, zwischen – plakativ gesagt: impulsivem Tier und rationalem Menschen. Ein lange sehr grundlegendes Prinzip, mit dem der Mensch seine Identität gegenüber dem Tier abgrenzt. Auf dieser Grenze balanciert die Katze.
Eine erkennbar „menschliche“ Individualität, Charakter und eigene Persönlichkeit als Protagonist gewinnt die Katze allerdings erst sehr viel später, um das Jahr 1800 herum. Es ist die Geburtsstunde der Katze als intellektueller literarischer Held – und als Provokateur.
02 O-Ton Heller (05:10 )
Das fängt an bei, würde ich zumindest sagen, dass es anfängt bei Ludwig Tieck, also dem Romantiker, Dramatiker, Novellisten, der das Kindermärchen „Der gestiefelte Kater“ bearbeitete und zu einer Theatersatire, also einem Drama, ausarbeitete, in dem dann eben, so ähnlich wie auch in dem Märchen von Charles Perrault, der Kater Hinze das Einzige ist, was der Müllersohn Gottlieb bekommt als Erbe, was natürlich im ersten Moment enttäuschend ist, bis sich dann heraussteht, diese Katze kann eben sprechen und verspricht Gottlieb, dass ihm dieses Erbe sozusagen Gutes bringen würde.
MUSIK „Die verwandelte Katze“
SPRECHERIN
Charles Perrault war in Frankreich das, was die Brüder Grimm in Deutschland wurden: Berühmt als Märchensammler. Und: als Verbreiter der Aufklärung. Märchen hatten oft eine erzieherische Moral, die im Sinne der Vernunft bilden sollte. Auch Erwachsene. Bereits im 18. Jahrhundert waren deutsche Übersetzungen Perraults im Umlauf. Darunter auch die prominente Geschichte vom gestiefelten Kater. Ludwig Tieck greift dieses literarische Gut der Aufklärung 1797 nicht ohne Hintergedanken auf und macht daraus eine Komödie.
SPRECHER (als Kater)
Was muss der Hund nicht alles tun und lernen! Wie wird das Pferd gemartert! Es sind dumme Tiere, dass sie sich ihren Verstand merken lassen, sie müssen ihrer Eitelkeit durchaus nachgeben; aber wir Katzen sind noch immer das freieste Geschlecht, weil wir uns bei aller unsrer Geschicklichkeit so ungeschickt anzustellen wissen, dass es der Mensch ganz aufgibt, uns zu erziehen.
SPRECHERIN
Die Erziehung aufzugeben, den Verstand aus List zu verstecken vor der Welt – diese Haltung des gestiefelten Katers provozierte das zeitgenössische Publikum bereits im Prolog, dessen Handlungsschauplatz das Theaterparkett selbst ist – das heißt, das Publikum weiß sehr genau: es ist selbst gemeint und wird nebenbei als banausisch, engstirnig, aber auch leicht manipulierbar vorgeführt.
SPRECHER (arrogant als Kater)
Wenn wir nicht im Umgang mit den Menschen eine gewisse Verachtung gegen die Sprache bekämen, so könnten wir alle sprechen.
MUSIK ENDE
SPRECHERIN
Der gestiefelte Kater balanciert auf dem Grat zwischen Tiefsinn und Unsinn. Tieck wählt ein kluges Tier, um die Überlegenheit des Intellekts zu hinterfragen, um übersättigtes Bildungsbürgertum und zeitgenössische Denkkonventionen zu geißeln. Er verwischt mit seiner Komödie die Grenzen zwischen Publikum und Bühne, hebt die Trennung auf zwischen Realität und Fantasie – und die reichlich seltsame Figur seines Katers mit all seinen besonderen Charakter-Eigenschaften ist seine schärfste Waffe