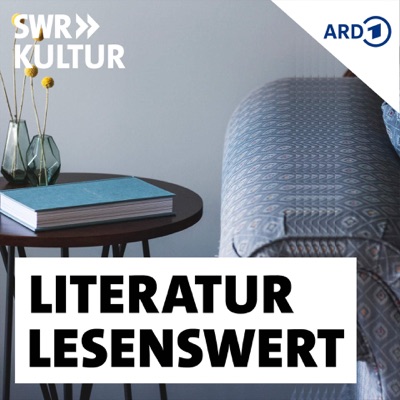Alles ist gut, solange du hip bist
Update: 2025-09-04
Description
Marian Flanders, 41 Jahre alt, betreibt eine Boutique in Berlin-Schöneberg. Seine Mutter Carolina, wichtigste Bezugsperson, stirbt. Sinnkrise? Fehlanzeige. Das Rezept zur Trauerbewältigung steckt schon im Titel von Leif Randts Roman: „Let’s Talk About Feelings“.
Alles normal, auch in Marians Alltag. „Kenting Beach“, wo er ausgewählte Labels und Second-Hand-Stücke verkauft, läuft zwar mäßig, richtig Sorgen macht Marian sich deswegen aber nicht. Normal. Exfreundin Franca ist schwanger vom neuen Partner, Halb-Schwester Teda und Freund Piet verlieben sich, Drogenausflüge nach Rügen oder auf Dates gehören dazu. Normal eben.
Gefühle werden endlos reflektiert, zwischen Freunden, Angestellten – und in Piets Podcast, der heißt, klar: „Let’s Talk About Feelings“.
Vierzehn Kapitel absolute Unaufgeregtheit führen Marian nach Japan, Teneriffa, Wolfsburg, Indien. Randt inszeniert seinen typischen „Hipsterrealismus“: nüchtern, repetitiv, modisch durchcodiert. Mode und Musik sind allgegenwärtig – erfundene Labels, fiktive Bands. Obwohl man sich da nicht sicher sein kann. Vielleicht sind sie eben nur so nischig, dass sie ausgedacht wirken?
Randt kombiniert Gegenwartsbeschreibungen und Fiktion, siedelt seinen Roman in naher Zukunft, 2026, an, in einem Berlin, in dem eine sozial-liberale Partei regiert.
Das Erstarken rechter Kräfte bleibt Randts Figuren weitgehend egal. Typisch Randt: eine dezent aufpolierte Gegenwart, in der alles glatt läuft und niemand aus der Bahn geworfen wird. Schon im Vorgänger „Allegro Pastell“ war das so.
Das Personal ist durchgestylt. Auch die Erzählhaltung ist vertraut: personale Perspektive, doch durch das hypertroph reflektierte Innenleben der Figuren fast auktorial. Dramaturgisch einförmig, sprachlich minimalistisch. Oft klingt das so:
„Marian fand, dass Piet mit zweiunddreißig für Schulzeitanekdoten entweder zu alt oder noch eine Ecke zu jung war“ oder „Marian fand, dass der Baumkuchen zu stark nach Butter schmeckte“ oder „Marian fand die Nachricht fair und gönnerhaft zugleich, aber keineswegs völlig unsympathisch“ oder „Marian fand das Wort Entlastung ein bisschen sexy“.
Was ist spannend an dieser Gleichförmigkeit? Sie provoziert Fragen: Was ist eigentlich aus der Übertreibung geworden? Divenhafte Gesten, das große Pathos? War es nicht mal cool, das Leben zur Bühne zu machen? Coole Literatur kam mit Paukenschlag daher, eine Frage des Übermaßes, des „Zu viel“. Elfriede Jelinek, deren Sprachgewalt mit einem kalkulierten Gestus der Zumutung einhergeht. In der Literaturgeschichte wimmelt es von Hybris, Streit, Mord, Totschlag, Exzentrik.
Bei Randt dagegen zeigt sich Coolness in der demonstrativen Unaufgeregtheit. Keine Explosion, sondern die Kunst der kontrollierten Untertreibung. Gelangweilte Erzähler, wie bei Popliteraten-König Christian Kracht in „Faserland“. Lakonie als eine Pose der distanzierten Teilhabe. Klar, in dieser Tradition bewegt sich Leif Randt.
Und er verfolgt ein schriftstellerisches Projekt: Utopien entwerfen, in denen Dramen gedämpft sind, der Puls flach bleibt. Schon in „Schimmernder Dunst über CobyCounty“ oder der Sci-Fi-Utopie „Planet Magnon“ schuf er solche Glanz- und Fantasiewelten
Auch in „Let’s Talk About Feelings“ ist alles durchästhetisiert, die Styles sitzen und die Frauen sind klug und schön. Marians geliebte Mutter war nicht weniger als ein erfolgreiches Model mit unfehlbarem Geschmack.
In dieser Welt sind Frauenfiguren Zierde oder seelische Stütze. Ob Mutter, potenzielle Partnerin, Haushälterin oder Angestellte – sie kreisen sämtlich um Marian, sorgen sich um sein Wohlergehen, flankieren sein Lebensgefühl. Frauen als hübsche Staffage.
So wirkt Randts Roman zwar wie eine männliche Utopie, dafür aber auch wie eine weibliche Dystopie: Berlin als Designer-Schaufenster, die Männer sprechen unendlich über ihre Gefühle, die Frauen halten ihnen dabei die Bühne frei. Eine Ästhetik der Unaufgeregtheit, die eine Welt entwirft, aber eben die alte: männlich dominiert, bequem eingerichtet, glatt wie mit einem Instagram-Filter.
„Let’s Talk About Feelings“: So könnte auch das Manifest für Performative Males heißen. Vielleicht aber ist genau das die unbeabsichtigte Pointe: dass Randts Roman als Parodie einer neuen männlichen Sensibilität lesbar wird.
Marian fühlte sich normal, weil die offenkundigsten Trauersymptome bereits abgeklungen waren. Er musste nicht mehr weinen, er war nicht antriebslos, er verlor sich nicht ständig in Erinnerungen. Auf Piets Nachfrage, ob Normalität für ihn etwas Gutes oder Schlechtes sei, präzisierte Marian: »Ich glaube, ich fühle mich so normal wie noch nie.«Quelle: Leif Randt: Let’s Talk About Feelings
Alles normal
Alles normal, auch in Marians Alltag. „Kenting Beach“, wo er ausgewählte Labels und Second-Hand-Stücke verkauft, läuft zwar mäßig, richtig Sorgen macht Marian sich deswegen aber nicht. Normal. Exfreundin Franca ist schwanger vom neuen Partner, Halb-Schwester Teda und Freund Piet verlieben sich, Drogenausflüge nach Rügen oder auf Dates gehören dazu. Normal eben.
Gefühle werden endlos reflektiert, zwischen Freunden, Angestellten – und in Piets Podcast, der heißt, klar: „Let’s Talk About Feelings“.
Leif Randts Hipsterrealismus
Vierzehn Kapitel absolute Unaufgeregtheit führen Marian nach Japan, Teneriffa, Wolfsburg, Indien. Randt inszeniert seinen typischen „Hipsterrealismus“: nüchtern, repetitiv, modisch durchcodiert. Mode und Musik sind allgegenwärtig – erfundene Labels, fiktive Bands. Obwohl man sich da nicht sicher sein kann. Vielleicht sind sie eben nur so nischig, dass sie ausgedacht wirken?
Randt kombiniert Gegenwartsbeschreibungen und Fiktion, siedelt seinen Roman in naher Zukunft, 2026, an, in einem Berlin, in dem eine sozial-liberale Partei regiert.
Marian, der mit der 2016 gegründeten Progress-Partei um Fatima Brinkmann und Valentin Izermeyer durchaus sympathisierte, aber bei der Bundestagswahl ‘22 vor allem wegen Gregor Gysi im letzten Moment dann die Linkspartei gewählt hatte, verfolgte regelmäßig die Frontal-Pressekonferenzen der Kanzlerin – auf ihrem YouTube-Channel reagierte sie auf gesammelte Fragen mit pointierten Ansprachen.Quelle: Leif Randt: Let’s Talk About Feelings
Schon bekannt aus „Allegro Pastell“
Das Erstarken rechter Kräfte bleibt Randts Figuren weitgehend egal. Typisch Randt: eine dezent aufpolierte Gegenwart, in der alles glatt läuft und niemand aus der Bahn geworfen wird. Schon im Vorgänger „Allegro Pastell“ war das so.
Das Personal ist durchgestylt. Auch die Erzählhaltung ist vertraut: personale Perspektive, doch durch das hypertroph reflektierte Innenleben der Figuren fast auktorial. Dramaturgisch einförmig, sprachlich minimalistisch. Oft klingt das so:
„Marian fand, dass Piet mit zweiunddreißig für Schulzeitanekdoten entweder zu alt oder noch eine Ecke zu jung war“ oder „Marian fand, dass der Baumkuchen zu stark nach Butter schmeckte“ oder „Marian fand die Nachricht fair und gönnerhaft zugleich, aber keineswegs völlig unsympathisch“ oder „Marian fand das Wort Entlastung ein bisschen sexy“.
Die Gleichförmigkeit wirft Fragen auf
Was ist spannend an dieser Gleichförmigkeit? Sie provoziert Fragen: Was ist eigentlich aus der Übertreibung geworden? Divenhafte Gesten, das große Pathos? War es nicht mal cool, das Leben zur Bühne zu machen? Coole Literatur kam mit Paukenschlag daher, eine Frage des Übermaßes, des „Zu viel“. Elfriede Jelinek, deren Sprachgewalt mit einem kalkulierten Gestus der Zumutung einhergeht. In der Literaturgeschichte wimmelt es von Hybris, Streit, Mord, Totschlag, Exzentrik.
Bei Randt dagegen zeigt sich Coolness in der demonstrativen Unaufgeregtheit. Keine Explosion, sondern die Kunst der kontrollierten Untertreibung. Gelangweilte Erzähler, wie bei Popliteraten-König Christian Kracht in „Faserland“. Lakonie als eine Pose der distanzierten Teilhabe. Klar, in dieser Tradition bewegt sich Leif Randt.
Eine durchästhetisierte Utopie
Und er verfolgt ein schriftstellerisches Projekt: Utopien entwerfen, in denen Dramen gedämpft sind, der Puls flach bleibt. Schon in „Schimmernder Dunst über CobyCounty“ oder der Sci-Fi-Utopie „Planet Magnon“ schuf er solche Glanz- und Fantasiewelten
Auch in „Let’s Talk About Feelings“ ist alles durchästhetisiert, die Styles sitzen und die Frauen sind klug und schön. Marians geliebte Mutter war nicht weniger als ein erfolgreiches Model mit unfehlbarem Geschmack.
Marian: „Als ich etwa fünfzehn Jahre alt war, habe ich mal zu meiner Mutter gesagt, dass ich keine Lust auf Kommunismus hätte, weil es da bestimmt nur eine eingeschränkte Auswahl an Klamotten geben würde, und dann hat sie gesagt, dass das gar nicht unbedingt stimmen müsse. Ich glaubte, ihr O-Ton war: Eventuell bekämen wir im Kommunismus weniger zu essen, aber dafür schönere Fashion.“
Piet: „Hatte deine Mutter eigentlich immer recht?“Quelle: Leif Randt: Let’s Talk About Feelings
Frauen sind hübsche Staffage
In dieser Welt sind Frauenfiguren Zierde oder seelische Stütze. Ob Mutter, potenzielle Partnerin, Haushälterin oder Angestellte – sie kreisen sämtlich um Marian, sorgen sich um sein Wohlergehen, flankieren sein Lebensgefühl. Frauen als hübsche Staffage.
So wirkt Randts Roman zwar wie eine männliche Utopie, dafür aber auch wie eine weibliche Dystopie: Berlin als Designer-Schaufenster, die Männer sprechen unendlich über ihre Gefühle, die Frauen halten ihnen dabei die Bühne frei. Eine Ästhetik der Unaufgeregtheit, die eine Welt entwirft, aber eben die alte: männlich dominiert, bequem eingerichtet, glatt wie mit einem Instagram-Filter.
„Let’s Talk About Feelings“: So könnte auch das Manifest für Performative Males heißen. Vielleicht aber ist genau das die unbeabsichtigte Pointe: dass Randts Roman als Parodie einer neuen männlichen Sensibilität lesbar wird.
Comments
In Channel