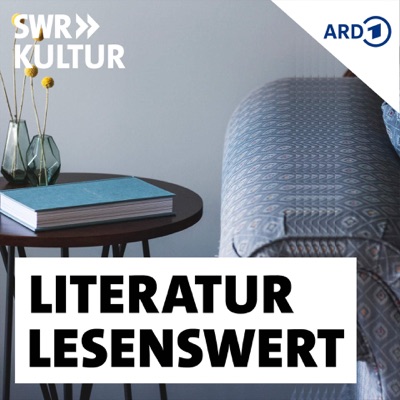Eine europäische Odyssee
Update: 2025-08-26
Description
Nach der Lektüre dieses fabelhaften Romans blickt man ungläubig auf die letzte Seitenzahl. 156 steht da. Auf engem Raum erzählt Katerina Poladjan – nein – nicht ein ganzes Leben oder Zeitalter, doch wehen Spuren davon durch den Text: von der ideologischen Wucht, die das 20. Jahrhundert geprägt hat. Von utopischen Entwürfen, kühnen Versuchen des Aus- und Aufbruchs. Und von den darauf folgenden Entzauberungen.
Poladjan findet gleich zu Beginn von „Goldstrand“ intensive Bilder, um die existentiellen Erfahrungen ihrer Figuren in Szene zu setzen. Da ist die berühmte Potemkinsche Treppe in Odessa, die eine junge Frau, ein kleiner Junge und ein Mann hinuntergehen. Kurz darauf betreten sie ein Schiff, und die junge Frau springt auf hoher See über Bord. All das vor laufender Kamera, denn wir befinden uns in einem Film. Wirklich?
Der Erzähler heißt Eli und ist Regisseur. In dem Film, der den Roman eröffnet, erzählt Eli die Geschichte seines Großvaters Lew, seines Vaters Felix und seiner Tante Vera. Es sei, so sagt Eli später einmal im Buch, furchtbar kompliziert, genau das Richtige stehen zu lassen. Katerina Poladjan ist eine Meisterin im Weglassen. Ihre Arbeitsweise vergleicht sie mit der eines Malers:
„Schreiben ist in erster Linie erzählen, und jedes Erzählen braucht seine eigene Ökonomie. Wenn ein Maler mit wenigen dunklen Linien Akzente und Schatten setzt, kann das Bild sehr viel Licht zeigen. Vielleicht versuche ich etwas Ähnliches beim Schreiben: mit den richtigen Konturen etwas plastisch werden lassen, was mit einem Übermaß an Details wieder verflachen würde. Ich versuche, Räume zu öffnen, von denen ich fürchte, dass sie sich bei farbiger Ausmalung wieder verschließen würden.“
„Goldstrand“ ist ein raffiniert gebautes Buch, das sich leicht, ja sogar heiter liest. Das liegt am Tonfall, den Poladjan findet; an den funkelnden Dialogen, die Eli mit der Dottoressa, seiner Therapeutin, führt. Vor ihr breitet er auf der Couch in einer mondän verfallenen römischen Altbauwohnung seine Familiengeschichte aus, eine europäische Irrfahrt. Von Odessa nach Istanbul, an die bulgarische Küste – bis nach Rom.
Der real existierende „Goldstrand“, ein sozialistisches Großprojekt nahe Warna in Bulgarien, ist ein zentraler Ort im Roman. Die Idee: Ferien für alle. Sichtbeton als Ausdruck revolutionärer Schönheit. Felix, Elis Vater, wird nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Architekt zu einem der Baumeister der gigantischen Anlage.
Elis Mutter Francesca, eine der hinreißendsten Figuren des Romans, die Ende der 1950er-Jahre entflammt in Begeisterung für die neue Linke, kommt als Teil einer Reisegruppe auf die Goldstrand-Baustelle und kehrt von dort nach einer Nacht mit Felix am Strand schwanger nach Rom zurück. Ihr Vater, ein glühender Mussolini-Anhänger, setzt sie vor die Tür. Eli wird in der düsteren Stadtvilla des Patriarchen großgezogen; seine Mutter wird dort nicht mehr geduldet.
Katerina Poladjan hat selbst mehrere Kindheitsurlaube in Goldstrand verbracht. Was bedeutet ihr dieser Ort?
„Eigentlich ist Goldstrand irgendein Ort; eine beinahe willkürlich gesetzte Station einer europäischen Odyssee. Aber auch ein Ort, der nach goldenem Glanz klingt, nach Goldsuche, nach Hoffnung auf Glück und Reichtum.“
So wird der Goldstrand im Roman zum Symbol: Ein Ort, in dem Menschen aller Nationen und aller Klassen zusammenkommen sollten. „Goldstrand“ ist ein Buch der hellen Utopien, die an den Klippen der Wirklichkeit zerschellt sind. Alle vermeintlichen Tatsachen kommen aus dem Mund eines professionellen Geschichtenerfinders.
Eli erzählt nicht nur sein Leben, er erzählt auch um sein Leben. So lange er redet, erschafft er sich eine Identität. Eli braucht Publikum, um Kontur zu bekommen,
Katerina Poladjan erzählt: „Und wie jedes Publikum ist die Dottoressa eine launische Zuhörerin. Sie hat Zweifel am Wahrheitsgehalt des Gehörten; sie hat eigene Vorstellungen, Wünsche, Erfahrungen, an denen sie das Gehörte misst.“
Was die Leser diesem Eli glauben können und was nicht? Unwichtig. Alles, was am Ende zählt, ist die Erzählung selbst. Und der beeindruckend kluge Roman, den Katerina Poladjan daraus gemacht hat.
Poladjan findet gleich zu Beginn von „Goldstrand“ intensive Bilder, um die existentiellen Erfahrungen ihrer Figuren in Szene zu setzen. Da ist die berühmte Potemkinsche Treppe in Odessa, die eine junge Frau, ein kleiner Junge und ein Mann hinuntergehen. Kurz darauf betreten sie ein Schiff, und die junge Frau springt auf hoher See über Bord. All das vor laufender Kamera, denn wir befinden uns in einem Film. Wirklich?
Eli, der Regisseur und die Kunst des Weglassens
Der Erzähler heißt Eli und ist Regisseur. In dem Film, der den Roman eröffnet, erzählt Eli die Geschichte seines Großvaters Lew, seines Vaters Felix und seiner Tante Vera. Es sei, so sagt Eli später einmal im Buch, furchtbar kompliziert, genau das Richtige stehen zu lassen. Katerina Poladjan ist eine Meisterin im Weglassen. Ihre Arbeitsweise vergleicht sie mit der eines Malers:
„Schreiben ist in erster Linie erzählen, und jedes Erzählen braucht seine eigene Ökonomie. Wenn ein Maler mit wenigen dunklen Linien Akzente und Schatten setzt, kann das Bild sehr viel Licht zeigen. Vielleicht versuche ich etwas Ähnliches beim Schreiben: mit den richtigen Konturen etwas plastisch werden lassen, was mit einem Übermaß an Details wieder verflachen würde. Ich versuche, Räume zu öffnen, von denen ich fürchte, dass sie sich bei farbiger Ausmalung wieder verschließen würden.“
„Goldstrand“ ist ein raffiniert gebautes Buch, das sich leicht, ja sogar heiter liest. Das liegt am Tonfall, den Poladjan findet; an den funkelnden Dialogen, die Eli mit der Dottoressa, seiner Therapeutin, führt. Vor ihr breitet er auf der Couch in einer mondän verfallenen römischen Altbauwohnung seine Familiengeschichte aus, eine europäische Irrfahrt. Von Odessa nach Istanbul, an die bulgarische Küste – bis nach Rom.
Familiengeschichte zwischen Rom, Odessa und dem Goldstrand
Der real existierende „Goldstrand“, ein sozialistisches Großprojekt nahe Warna in Bulgarien, ist ein zentraler Ort im Roman. Die Idee: Ferien für alle. Sichtbeton als Ausdruck revolutionärer Schönheit. Felix, Elis Vater, wird nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Architekt zu einem der Baumeister der gigantischen Anlage.
Elis Mutter Francesca, eine der hinreißendsten Figuren des Romans, die Ende der 1950er-Jahre entflammt in Begeisterung für die neue Linke, kommt als Teil einer Reisegruppe auf die Goldstrand-Baustelle und kehrt von dort nach einer Nacht mit Felix am Strand schwanger nach Rom zurück. Ihr Vater, ein glühender Mussolini-Anhänger, setzt sie vor die Tür. Eli wird in der düsteren Stadtvilla des Patriarchen großgezogen; seine Mutter wird dort nicht mehr geduldet.
Für Katerina Poladjan ist der Goldstrand mehr als literarische Kulisse
Katerina Poladjan hat selbst mehrere Kindheitsurlaube in Goldstrand verbracht. Was bedeutet ihr dieser Ort?
„Eigentlich ist Goldstrand irgendein Ort; eine beinahe willkürlich gesetzte Station einer europäischen Odyssee. Aber auch ein Ort, der nach goldenem Glanz klingt, nach Goldsuche, nach Hoffnung auf Glück und Reichtum.“
So wird der Goldstrand im Roman zum Symbol: Ein Ort, in dem Menschen aller Nationen und aller Klassen zusammenkommen sollten. „Goldstrand“ ist ein Buch der hellen Utopien, die an den Klippen der Wirklichkeit zerschellt sind. Alle vermeintlichen Tatsachen kommen aus dem Mund eines professionellen Geschichtenerfinders.
Eli erzählt nicht nur sein Leben, er erzählt auch um sein Leben. So lange er redet, erschafft er sich eine Identität. Eli braucht Publikum, um Kontur zu bekommen,
Katerina Poladjan erzählt: „Und wie jedes Publikum ist die Dottoressa eine launische Zuhörerin. Sie hat Zweifel am Wahrheitsgehalt des Gehörten; sie hat eigene Vorstellungen, Wünsche, Erfahrungen, an denen sie das Gehörte misst.“
Was die Leser diesem Eli glauben können und was nicht? Unwichtig. Alles, was am Ende zählt, ist die Erzählung selbst. Und der beeindruckend kluge Roman, den Katerina Poladjan daraus gemacht hat.
Comments
In Channel