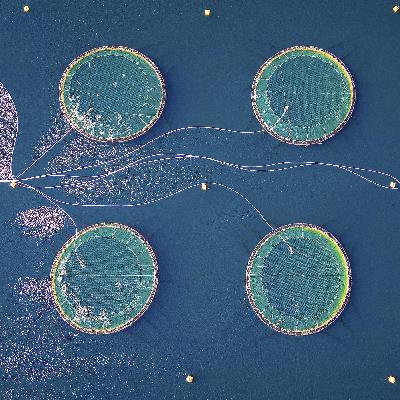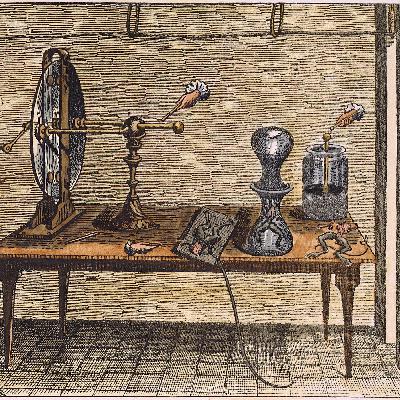Aquakulturen - Fluch oder Segen?
Description
Seit 30 Jahren stagnieren die Fänge der Wildfischerei. Schon jetzt stammt jeder zweite weltweit konsumierte Fisch aus Aquakulturen. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung gewinnt die Aquakultur als Lebensmittellieferant enorm an Bedeutung.
Credits
Autoren dieser Folge: Jörn Breiholz und Michael Marek
Regie: Christiane Klenz
Es sprachen: Katja Amberger, Peter Veit
Redaktion: Bernhard Kastner
Im Interview:
Reinhold Hanel, Direktor des Instituts für Fischereiökologie am "Johann Heinrich von Thünen-Institut" für Fischerei in Bremerhaven
Ulfert Focken, Fischerei-Ökologe, "Thünen-Institut"
Jón Kaldal, Journalist, Icelandic Wildlife Fund, NGO Island
Daniel Jakobsson, Geschäftsführer Arctic Fish, Lachszuchtunternehmen
Elvar Friðriksson, Geschäftsführer North Atlantic Salmon Fund, NGO Island
Sigurdur Thorvsalds, Biologe und Naturschützer, Island
Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren:
Schlangengrube - WirTier
Markus hat als Tierarzt eine Mission: Reptilien vor Leid bewahren. Er kümmert sich um Schlangen aus Qualzuchten oder auch um exotische Tiere, die als Ware illegal gehandelt und wenig artgerecht gehalten werden. Host Vici nimmt für WirTier ihren Mut zusammen: Schafft sie es, Schlangen auf Augenhöhe zu begegnen? HIER geht es zur Folge.
Überfischung - Wenn das Meer leer wird HIER
Fische - Die unterschätzten Lebewesen HIER
Der Aal - Ein Fisch voller Rätsel HIER
Hör-Tipp:
Lost - Björk & Rosalia, 2023 auf YouTube
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
Sprecherin:
Bremerhaven an der deutschen Nordseeküste: Im beschaulich-historischen Fischereihafen riecht es nach Fish and Chips. Fangschiffe gibt es hier schon lange nicht mehr. Stattdessen: Räuchereien, Restaurants und Souvenirläden. Einen Steinwurf entfernt steht ein neues, modernes Glas-und-Stahl-Gebäude.
O-Ton 1: Ulfert Focken
"Wir sind hier in der Aquakultur Forschungsanlage des Thünen-Instituts für Fischereiökologie in Bremerhaven."
ATMO: Thünen-Institut / Sicherheitsschleuse
Sprecherin:
Sagt Professor Ulfert Focken. Wir stehen mit dem Spezialisten für Aquakultur und Fischernährung hinter der Sicherheitsschleuse im Erdgeschoss.
Ein leicht muffiger Geruch liegt in der Luft – wegen der Feuchtigkeit, erklärt der Wissenschaftler. In gut einem Dutzend Wasserbassins schwimmen verschiedene Fischarten unterschiedlicher Größe:
O-Ton 2: Ulfert Focken
"Hier sind verschiedene Becken von zahlreichen Aquarien mit circa 50 Litern bis hin zu Becken mit zwei Meter 50 Durchmesser, wo wir Tiere des warmen Bereiches halten. Das sind hier bei uns in erster Linie Karpfen und daneben auch tropische Garnelen, die sogenannte Pazifische Weißwein-Garnele. Wir machen hier Forschung in erster Linie zur Haltung und Fütterung dieser Arten."
MUSIK 1 ( SINE - Lost And Never Found 0’37)
Sprecherin:
Seit gut 30 Jahren beschäftigt sich Focken mit Aquakulturen, also der Erzeugung von Organismen, die im Wasser leben. Im Gegensatz zur Fangfischerei werden in der Aquakultur Fische wie zum Beispiel Lachse, Karpfen oder Doraden, aber auch Krebstiere, Muscheln und Algen unter kontrollierten Bedingungen aufgezogen. Aquakultur ist sozusagen Landwirtschaft unter Wasser. Für Focken wie auch für seinen Kollegen Professor Reinhold Hanel sind Aquakulturen für die Welternährung unverzichtbar:
O-Ton 3: Reinhold Hanel
"Wir werden sehr oft gefragt: Aquakultur - ja oder nein? Diese Frage wird immer nur in Deutschland gestellt. Weltweit würde die niemand stellen, weil man müsste, um sozusagen dieselbe Frage auf die Landwirtschaft umzumünzen, zu sagen, Landwirtschaft ja oder nein. Und die Frage würde niemand ernsthaft stellen. Sondern man redet dann über Schweinezucht oder über Geflügel oder irgendwelche Ackerfrüchte. Aber man stellt nicht grundsätzlich die Ernährungsproduktion des Menschen infrage. Und die Aquakultur hat in vielen Kontinenten, gerade in Asien, einen Stellenwert, der dem der Agrikultur, der Landwirtschaft, entspricht."
MUSIK 2 ( SINE - Lost And Never Found 0’36)
Sprecherin:
Reinhold Hanel leitet das Thünen-Instituts für Fischereiökologie; es ist eines von drei Instituten, die im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft die Fischerei erforschen. Er ist Experte für den europäischen Aal, für Biodiversität, Populationsgenetik und Aquakultur:
O-Ton 4: Reinhold Hanel
"Und ohne Aquakultur hätten wir keine Chance, den Menschen zu ernähren. Und eine steigende Weltbevölkerung, also die Zunahme an Nahrungsmitteln, sieht die Welternährungsorganisation fast ausschließlich über eine Zunahme der Aquakultur. Wir müssen also Wasser, Meeresflächen, aber auch Binnengewässer teilweise noch stärker als bisher für die Nahrungsmittelproduktion nutzen, wenn wir eine steigende Weltbevölkerung in ausreichendem Maße mit Nahrung beliefern wollen."
ATMO Thünen Institut / Aquakulturanlage
Sprecherin:
Aber ist die Produktion jeder Fischart sinnvoll und nachhaltig, um alle Menschen satt zu bekommen? Was ist etwa mit dem in Deutschland und vielen anderen Ländern beliebtesten Speisefisch, dem Lachs?
O-Ton 5: Reinhold Hanel
"Der Lachs hat nun mal ein relativ hohes Grundbedürfnis an Nahrungsqualität als Fleischfresser. Aber dasselbe gilt natürlich auch für den Thunfisch - vor allem der aus dem Farming kommt, also der sozusagen gemästet wird. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Dorade und für den Wolfsbarsch. Das sind alles Fische, die nicht für die Welternährung gezüchtet werden, sondern um einen Nischenmarkt zu bedienen."
ATMO Thünen Institut / Aquakulturanlage
Sprecherin:
Das Futter ist das mit Abstand wichtigste Instrument, mit dem die Fischfarmen Wachstum und Gesundheit der Tiere steuern können. Auch deswegen erforscht das Thünen-Institut hier in Bremerhaven vor allem das Futter und seine Auswirkungen auf Zuchtfische:
O-Ton 6: Ulfert Focken
"Das Erkenntnisinteresse aktuell liegt nicht in der Züchtung. Das sind zwar die Ursprünge dieser Arbeitsgruppe von Anfang der 1960er-Jahre, wo man versucht hat, den grätenarmen Karpfen zu züchten. Bei uns geht es um die Untersuchung zur Fütterung und zur Umweltwirkung. Denn ein Futter, was schlecht verwertet ist, produziert natürlich mehr Ausscheidungen als ein hochwertiges Futter."
MUSIK 3 ( SINE – Always 0’48)
Sprecherin:
Haben die Fischfarmen die Jungfische erst einmal von der Brutstation zum Mästen in die Käfige im Meer, Fluss oder in den Teich transportiert, können sie die Wassertemperatur nicht mehr regulieren, die Fische nicht mehr impfen – und: auch einzelne Tiere nicht mehr isolieren. In der Mäst-Phase bestimmen vor allem Wassertemperatur und -qualität das Wachstum der Tiere – aber eben auch und vor allem das Futter. Das hat heute eine ganz andere Zusammensetzung als noch vor einigen Jahren, erklärt Ulfert Focken:
O-Ton 7: Ulfert Focken
"In den 1980er-Jahren, als die industrielle Lachszucht in Norwegen begann, bestand das Lachsfutter noch zu circa 50 Prozent aus Fischmehl und 10 bis 15 Prozent Fischöl. Und zu dieser Zeit wurden, um ein Kilogramm Lachs zu produzieren, vier bis fünf Kilogramm Sardinen, Sardellen und ähnliche Fische gebraucht, die dann zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet wurden. Inzwischen ist die Lachsproduktion weltweit aber größer als der Fang von Fischen zur Fischmehl-Erzeugung. Und im Laufe der Zeit ist der Fischmehl-Anteil im Futter auf unter zehn Prozent gesunken."
MUSIK 4 ( SINE – Always 0’32)
Sprecherin:
Raubfische wie Thunfisch, Dorade, Wolfsbarsch oder Lachs ernähren sich in ihrem natürlichen Habitat von anderen Fischen und Krebsen. Wenn der Lachs aber in der Aquakultur nicht einmal mehr zehn Prozent Fischanteil im Futter bekommt, woraus bestehen die anderen 90 Prozent seiner Nahrung in der Mästung? Ulfert Focken:
O-Ton 8: Ulfert Focken
"Es sind einerseits in gewissen Mengen Tiermehle, aber der überwiegende Teil sind Pflanzenproteine. Und da in erster Linie eben Soja basierende Proteine. Das ist natürlich keine natürliche Nahrung für den Lachs. Und wenn wir den Lachsen wie auch vielen anderen Fischen einfach rohes Sojamehl geben, dann führt es zu chronischer Darmentzündung."
ATMO Hafen / Möwen
Sprecherin:
Das bedeutet: Das pflanzliche Fut