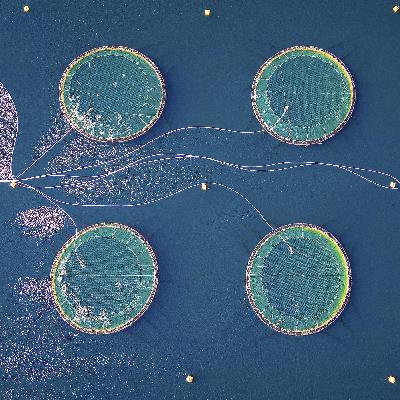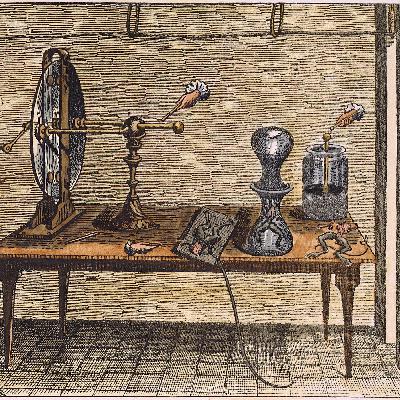Vertragsarbeiter in der DDR - Fremd im Bruderstaat
Description
Sie lebten abgeschottet von der restlichen Bevölkerung, denn eine dauerhafte Einwanderung war nicht erwünscht: Die sogenannten Vertragsarbeiter aus Vietnam, Mosambik, Angola, Polen oder Ungarn, die den Mangel an Arbeitskräften in der DDR ausgleichen sollten. Wie erging es ihnen nach der Wende? Autorin: Maike Brzoska
Credits
Autorin dieser Folge: Maike Brzoska
Regie: Susi Weichselbaumer
Es sprachen: Dorothea Anzinger, Jerzy May
Redaktion: Nicole Ruchlak
Im Interview:
Ann-Judith Rabenschlag Karpe, Historikerin, Universität Stockholm;
Birgit Weyhe, Illustratorin des Comic-Buches “Madgermanes”;
Thach Nguyen, ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter;
Tamara Hentschel, DDR-Wohnheim-Betreuerin, Bürgerrechtlerin
Diese hörenswerten Folgen von radioWissen könnten Sie auch interessieren:
Max Frisch - Der Kampf ums Ich
JETZT ANHÖREN
Migrationsliteratur - Weggehen, Ankommen, Weiterleben
JETZT ANHÖREN
Linktipps:
Noch mehr Interesse an Geschichte? Dann empfehlen wir:
ALLES GESCHICHTE - HISTORY VON RADIOWISSEN
Skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Das Kalenderblatt erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum. Ein Angebot des Bayerischen Rundfunks.
DAS KALENDERBLATT
Frauen ins Rampenlicht! Der Instagramkanal frauen_geschichte versorgt Sie regelmäßig mit spannenden Posts über Frauen, die Geschichte schrieben. Ein Angebot des Bayerischen Rundfunks.
EXTERNER LINK | INSTAGRAMKANAL frauen_geschichte
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
RadioWissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | RadioWissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
MUSIK Motivated work Z8034318 119 0.44 Min.
SPRECHERIN
Im April 1980 beschließen die Regierungen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sozialistischen Republik Vietnam einen Staatsvertrag.
ZITATOR
Geleitet vom Wunsch zur Vertiefung der brüderlichen Zusammenarbeit (…) haben die Regierungen (…) folgendes vereinbart: Die Regierung der DDR gewährleistet vietnamesischen Facharbeitern (…) für die Dauer von jeweils vier Jahren die Aufnahme einer Beschäftigung in Betrieben (…) der Deutschen Demokratischen Republik.
SPRECHERIN
Der Grund ist einfach, sagt die Historikerin Ann-Judith Rabenschlag Karpe. Sie hat an der Universität Stockholm ihre Dissertation über Vertragsarbeit in der DDR geschrieben.
01 O-TON (Rabenschlag Karpe)
Der Grund ist in der DDR genau derselbe wie in Westdeutschland und in ganz vielen anderen europäischen Staaten. Es besteht schlicht und ergreifend ein Arbeitskräftemangel.
SPRECHERIN
Aber anders als die Bundesrepublik, wo die Fachkräfte vor allem aus der Türkei und Italien kommen, wirbt die DDR Arbeitskräfte aus sozialistischen Staaten an.
02 O-TON (Rabenschlag Karpe)
Die DDR schließt die ersten Verträge mit Polen und Ungarn. Und dann, im Laufe der 70er Jahre erweitert sich der geografische Fokus und man wirbt in Afrika, in Lateinamerika, in Asien an. Und dann die größten Gruppen kommen aus Mosambik und Vietnam.
MUSIK Königskinder Z8038689 103 0.55 Min.
SPRECHERIN
Anfangs sind es sehr wenige. Die große Mehrheit kommt erst in den 1980er Jahren in die DDR.
03 O-TON (Rabenschlag Karpe)
Es beginnt mit sehr kleinen Zahlen Anfang der 60er Jahre mit ein paar 100 polnischen Arbeitern. Und Ende der 80er Jahre sind wir dann bei gut 90.000.
SPRECHERIN
Die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern übernehmen größtenteils unbeliebte Tätigkeiten in der DDR.
04 O-TON (Rabenschlag Karpe)
Das sind Arbeiten, die physisch anstrengend sind, im Schichtdienst, mit Nachtdiensten verbunden, am Fließband, Arbeitsplätze, an denen man Lärm ausgesetzt ist, unangenehmen Gerüchen, und so weiter. Also alle Arbeitsfelder, die für jemanden, der sich zwischen mehreren Jobs entscheiden kann, nicht die erste Wahl sind.
SPRECHERIN
Die vielen unbesetzten Stellen sind ein Problem für die Planwirtschaft der DDR. Die Maschinen sind nicht ausgelastet, die Norm kann nicht erfüllt werden. Eigentlich hätte in vielen Betrieben Tag und Nacht gearbeitet werden müssen, aber die Leute fehlen.
05 O-TON (Hentschel)
Am Anfang hat man versucht, die DDR-Bürger für das Schichtsystem zu gewinnen, das ist aber nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, so dass man dann Arbeitskräfte in den sozialistischen Bruderländern angeworben hat.
SPRECHERIN
Tamara Hentschel betreut damals Arbeitskräfte aus Vietnam. Sie erklärt, wie alles funktioniert und hilft bei Sprachproblemen.
MUSIK Work in progress red 2 Z803431827 0.31 Min.
SPRECHERIN
Viele der vietnamesischen Arbeitskräfte, insbesondere die Frauen, arbeiten in der Textilindustrie. Hentschels Vietnamesinnen zum Beispiel im Betrieb „Herrenbekleidung Fortschritt“. Im Akkord schneidern sie Hosen und Hemden.
06 O-TON (Hentschel)
Wo man nicht mit gerechnet hatte, war, dass die Vietnamesen sehr geschickt sind und auch die Norm gebrochen haben, dadurch gab es dann auch sehr viele Konflikte, also in der Textilindustrie war das so, sehr viele Konflikte mit den deutschen Arbeitskräften.
SPRECHERIN
Denn wer die Norm übererfüllt, also ein Normbrecher ist, setzt die Kollegen unter Druck, ebenfalls schneller zu arbeiten. Anders als die Frauen werden die Männer aus Vietnam oft auf dem Bau eingesetzt. Hier kommt es ebenfalls zu Problemen.
07 O-TON (Hentschel)
Im Baugewerbe gab´s ganz viele Unfälle, weil die Vietnamesen im Gegensatz zu deutschen Bauarbeitern und mosambikanischen Bauarbeitern sehr klein und schmächtig waren, und da gab es sehr viele Unfälle, die darauf zurückzuführen waren, dass die Arbeit einfach mal viel zu schwer war.
MUSIK Needle and twin Z8019017 122 1.11 Min.
SPRECHERIN
Schwere Arbeit, von der sie sich kaum erholen können, denn die Wohnverhältnisse sind beengt. Die Vertragsarbeiter leben, nach Geschlechtern getrennt, in Wohnheimen.
08 O-TON (Hentschel)
Zum Beispiel ne Dreiraumwohnung mit neun Personen in drei verschiedenen Schichten mit einer Küche und einem Bad. Und, ich weiß nicht, ob das im Westteil so bekannt ist, diese Badzellen, hat man dazu gesagt, das waren so ungefähr fünf Quadratmeter: ne Badewanne, ein Waschbecken, ne Toilette. Es gab keine Waschmaschine, also für die neun Personen musste alles mit der Hand gewaschen werden und dann in der Wohnung auch getrocknet werden. Und die Küche war meistens ein Durchgangszimmer zu einem anderen Zimmer, wo andere wiederum geschlafen hatten, weil sie Nachtschicht hatten. Und dann wurde versucht, mit zusätzlichen Kochplatten in den Zimmern dann zu kochen, was verboten war, und das war so meine Tätigkeit, aufzupassen wegen Brandschutz und Hygiene und so weiter.
SPRECHERIN
Das Leben in den Wohnheimen ist streng geregelt.
MUSIK Dark Tunnel Z8023930 109 0.30 Min.
ZITATOR
Heimordnung für das Betriebswohnheim „Insel“ des VEB Papierfabrik Dreiwerden. (…) Zur konsequenten Durchsetzung der Prinzipien von Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit und Disziplin sind nachstehend aufgeführte Festlegungen einzuhalten. Die Zimmerzuweisung wird durch den Gruppenleiter getroffen. Ein selbständiges Umziehen in andere Zimmer (…) ist nicht statthaft. Es ist nicht gestattet, die Zimmereinrichtung auszuwechseln.
SPRECHERIN
Um 22 Uhr werden die Wohnheime geschlossen. Nur Schichtarbeitende dürfen dann noch ein- und ausgehen. Übernachtungen müssen genehmigt werden. Das gilt auch für Ehepaare. Denn die leben meist nicht zusammen, sondern sind ebenfalls nach Geschlecht getrennt untergebracht. Auch Kontakte zur deutschen Bevölkerung sind nicht erwünscht.
09 O-TON (Hentschel)
Also erstmal waren sie ja im Wohnheim isoliert, die Bevölkerung rundrum war nicht informiert über den Einsatz. Warum sind die hier? Wer sind die überhaupt? Und persönliche Kontakte, wenn die nicht im Arbeitsprozess erfolgt sind, haben die eigentlich nicht stattgefunden.
MUSIK Motivated Work Z8034318 119 0.50 Min.
SPRECHERIN
Integration ist ohnehin nicht vorgesehen. Die Arbeitskräfte sollen vier oder fünf Jahre in der DDR bleiben, um zu arbeiten, und dann in ihr Heimatland zurückkehren. Dennoch kommt es immer wieder zu Kontakten zur DDR-Bevölkerung, auch zu Freundschaften und Liebesbeziehungen. Und mancherorts entsteht ein Austausch, der einträglich ist für beide Seiten. Hentschels Vietnamesinnen und Vietnam