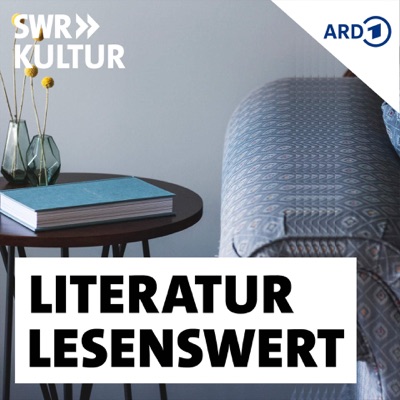Doris Dörrie – Wohnen
Update: 2025-09-08
Description
Doris Dörrie beginnt ihre Reise in ihrem rosa-grünen Kinderzimmer mit Märchentapete, ihrem „Boudoir", wie sie es nennt, wo sie im zerwühlten Bett in literarische Welten eintaucht. Wir folgen ihr in linke Studentenbuden, in denen aus Rebellion gegen das spießige Kleinbürgertum Türen ausgehängt und Matratzen auf den Boden gelegt werden.
Schließlich erzählt sie von ihrem Umzug aufs Land mit Mann und Kind. Dörrie hat in ihrem Leben intensiv und variantenreich gewohnt, beschreibt sich dabei selbst als keine sonderlich befähigte Wohnende, sofern man an diesem Konzept überhaupt scheitern kann.
So wie Dörrie die Wohnkonzepte anderer interessieren, dürfte die Leser vom Wohnen der Doris Dörrie fasziniert sein. Ziehen nicht erleuchtete Fenster in der Nacht unsere Blicke magisch an, weil sie Einblick in fremde Leben gewähren? Dörrie lädt uns ein, Voyeure ihrer ganz persönlichen Wohnabenteuer zu werden.
Dabei bedient sie sich einer kapitelbefreiten, assoziativen Gedankenführung. Sie springt von Hausbesichtigungen in Luxusvillen in Los Angeles zu düsteren Zimmern in Obdachlosenunterkünften und WGs mit drogendealenden, messerschwingenden Mitbewohnern in New York.
Der rote Faden, der alles zusammenhält, scheint weniger eine Angelegenheit des Wohnens und vielmehr eine Frage des Reviers zu sein. Stets geht es Dörrie auch um die Machtdynamiken zwischen Mann und Frau.
Wie verhalten sich die Geschlechter zueinander in den eigenen vier Wänden? Gibt es tatsächlich so etwas wie weibliches und männliches Wohnen? Wurde der Frau nicht seit jeher die Küche zugewiesen, um ihrer Verpflichtung zur Nützlichkeit nachzukommen?
Doris Dörrie verhandelt das Selbstverständnis der wohnenden Frau, auch im Hinblick auf ihre eigene Mutter, deren Verhältnis zu ihr sie behutsam aufarbeitet:
Virginia Woolfs “Room of one's own” schwebt wie ein Mantra über dem Text. Dörrie reflektiert die Bedeutung eigener Räume für Frauen und die ebenso wichtige Fähigkeit, diese wieder verlassen zu können.
Während Dörrie gegen anerzogene Wohnmuster rebelliert, indem sie schon als Kind die vorgesehene Ordnung in ihrem Puppenhaus durcheinanderwirft, erklärt sie die Küche zu einem hochpolitischen Ort, entwirft eher beiläufig Konzepte für neue Wohnmodelle und fragt zwischendurch nach dem Verbleib der Wohnrevolution.
Zum Ende schlägt sie die Brücke zu den allgemein verbindlichen Problemen unserer Zeit: unbezahlbare Mieten, der schwindende Traum vom Eigenheim und die ineffiziente Verteilung von Wohnraum. Im Endeffekt überwiegt jedoch die persönliche Anekdote gegenüber der gesellschaftspolitischen Analyse.
Doris Dörrie hat letztlich einen sehr persönlichen, autobiografischen Text verfasst, und keine akademische Abhandlung über das schwer zu greifende Konzept des Wohnens.
Für Dörrie-Fans ist das Buch ein wahres Fest der Indiskretion: Am Ende hat man so viel mit ihr durchlebt, dass man beinahe vergisst, dass nebenbei auch gewohnt wurde.
Schließlich erzählt sie von ihrem Umzug aufs Land mit Mann und Kind. Dörrie hat in ihrem Leben intensiv und variantenreich gewohnt, beschreibt sich dabei selbst als keine sonderlich befähigte Wohnende, sofern man an diesem Konzept überhaupt scheitern kann.
Meine Schwestern wohnen ganz anders als ich. Sie interessieren sich für Möbel und Design, in ihren Wohnungen herrscht Schönheit und Ordnung, sie sind neben ihren Berufen fantastische Köchinnen und Gärtnerinnen. Ich dagegen bin nie der Wohntyp gewesen, mich hat mein eigenes Wohnen nie so wirklich interessiert, sondern immer eher das Wohnen der anderen.Quelle: Doris Dörrie – Wohnen
Dörrie lädt zu ganz persönlichen Wohnabenteuern ein
So wie Dörrie die Wohnkonzepte anderer interessieren, dürfte die Leser vom Wohnen der Doris Dörrie fasziniert sein. Ziehen nicht erleuchtete Fenster in der Nacht unsere Blicke magisch an, weil sie Einblick in fremde Leben gewähren? Dörrie lädt uns ein, Voyeure ihrer ganz persönlichen Wohnabenteuer zu werden.
Dabei bedient sie sich einer kapitelbefreiten, assoziativen Gedankenführung. Sie springt von Hausbesichtigungen in Luxusvillen in Los Angeles zu düsteren Zimmern in Obdachlosenunterkünften und WGs mit drogendealenden, messerschwingenden Mitbewohnern in New York.
Revierkämpfe
Der rote Faden, der alles zusammenhält, scheint weniger eine Angelegenheit des Wohnens und vielmehr eine Frage des Reviers zu sein. Stets geht es Dörrie auch um die Machtdynamiken zwischen Mann und Frau.
Wie verhalten sich die Geschlechter zueinander in den eigenen vier Wänden? Gibt es tatsächlich so etwas wie weibliches und männliches Wohnen? Wurde der Frau nicht seit jeher die Küche zugewiesen, um ihrer Verpflichtung zur Nützlichkeit nachzukommen?
Doris Dörrie verhandelt das Selbstverständnis der wohnenden Frau, auch im Hinblick auf ihre eigene Mutter, deren Verhältnis zu ihr sie behutsam aufarbeitet:
Wir waren zu sechst, vier Kinder, ein Vater, der nur zu den Mahlzeiten auftauchte und sonst arbeitete, eine Mutter, die immer zuhause und dort nützlich war, mir als Kind aber seltsam ortlos erschien, wie nicht ganz existent. Einen eigenen Raum, ein eigenes Zimmer, hatte sie nicht, was keinem von uns jemals auffiel. Aber wozu auch? Sie hatte doch die ganze Wohnung!Quelle: Doris Dörrie – Wohnen
Virginia Woolfs “Room of one's own” schwebt wie ein Mantra über dem Text. Dörrie reflektiert die Bedeutung eigener Räume für Frauen und die ebenso wichtige Fähigkeit, diese wieder verlassen zu können.
Rebellionen und Realitäten
Während Dörrie gegen anerzogene Wohnmuster rebelliert, indem sie schon als Kind die vorgesehene Ordnung in ihrem Puppenhaus durcheinanderwirft, erklärt sie die Küche zu einem hochpolitischen Ort, entwirft eher beiläufig Konzepte für neue Wohnmodelle und fragt zwischendurch nach dem Verbleib der Wohnrevolution.
Zum Ende schlägt sie die Brücke zu den allgemein verbindlichen Problemen unserer Zeit: unbezahlbare Mieten, der schwindende Traum vom Eigenheim und die ineffiziente Verteilung von Wohnraum. Im Endeffekt überwiegt jedoch die persönliche Anekdote gegenüber der gesellschaftspolitischen Analyse.
Doris Dörrie hat letztlich einen sehr persönlichen, autobiografischen Text verfasst, und keine akademische Abhandlung über das schwer zu greifende Konzept des Wohnens.
Für Dörrie-Fans ist das Buch ein wahres Fest der Indiskretion: Am Ende hat man so viel mit ihr durchlebt, dass man beinahe vergisst, dass nebenbei auch gewohnt wurde.
Comments
In Channel