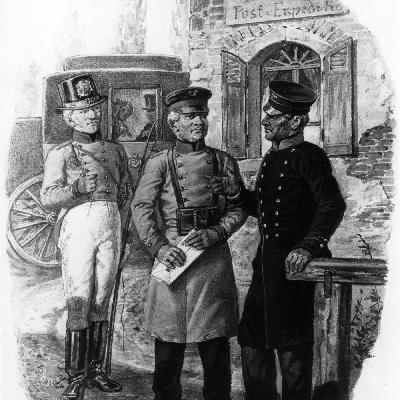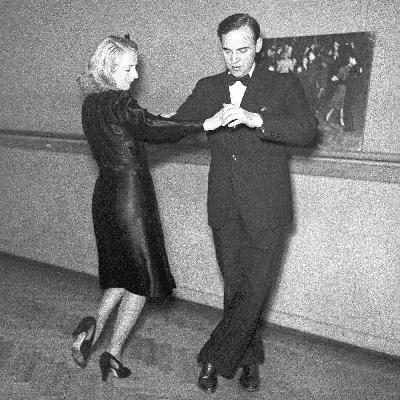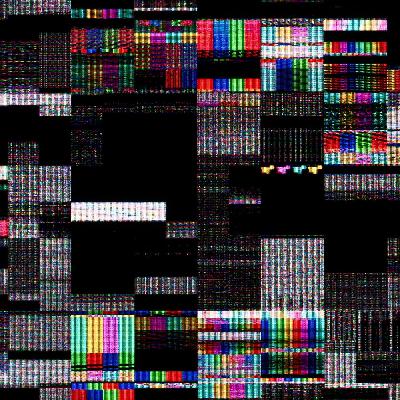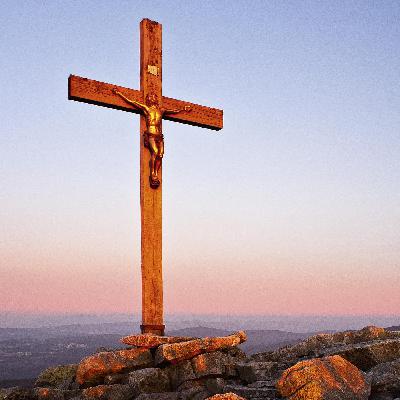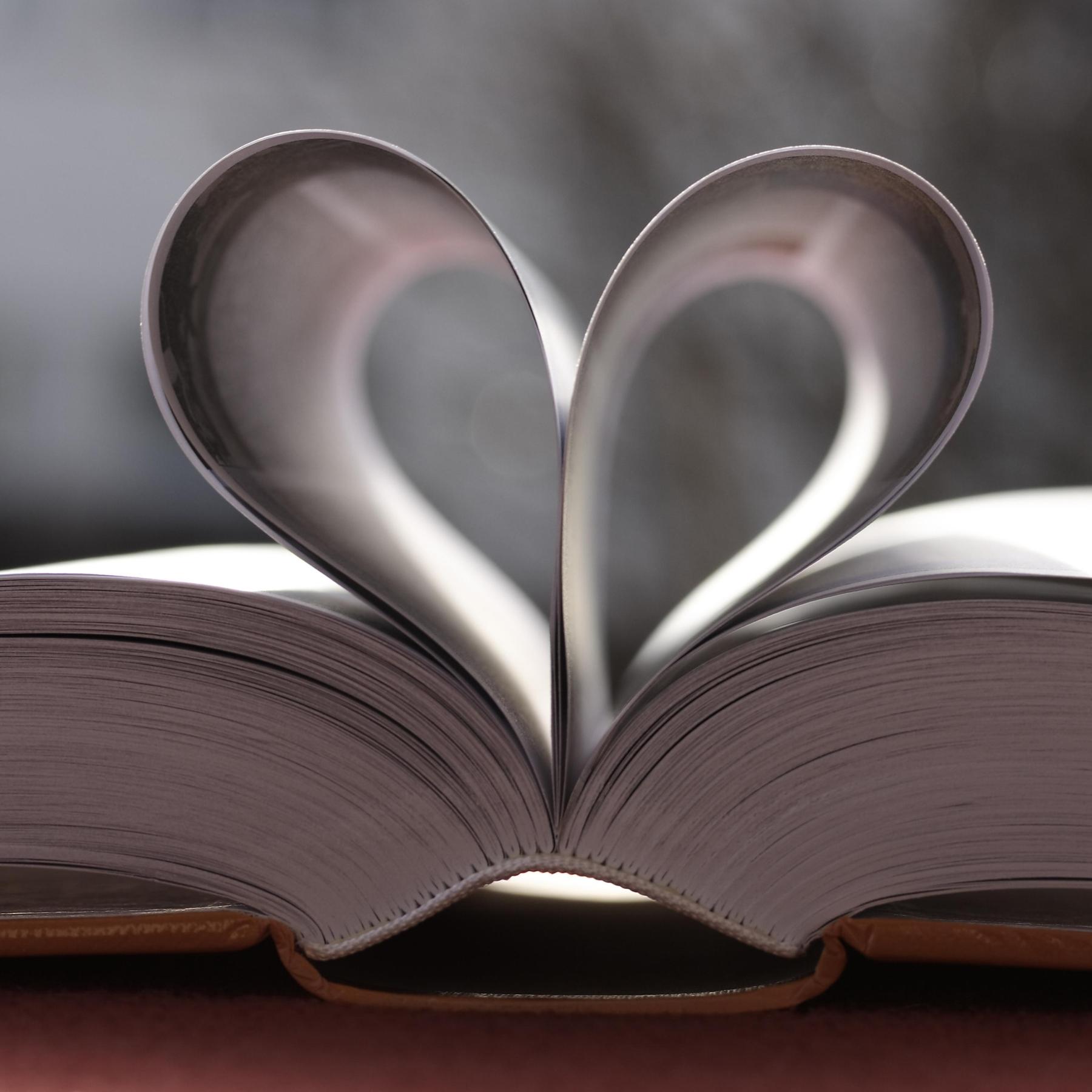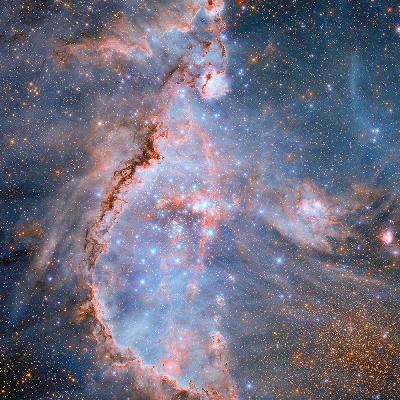Schrittweise frei - Die jüdische Bevölkerung Bayerns im 19 Jahrhundert
Description
Jahrhundertelang war die jüdische Bevölkerung in Bayern benachteiligt. Mit der Aufklärung wurde die Diskriminierung schrittweise beseitigt, bis mit der Reichsgründung 1871 die Emanzipation abgeschlossen war - vor dem Gesetz, jedoch noch lange nicht in den Köpfen. Von Julia Devlin
Credits:
Autorin: Julia Devlin
Regie: Anja Scheifinger
Sprecher:innen: Hemma Michel, Christian Baumann
Redaktion: Thomas Morawetz
Interviews:
Dr. Julia Schneidawind, Ludwig-Maximilians-Universität München
Literatur (Beispiele):
- Rolf Kießling: Jüdische Geschichte in Bayern. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin 2019 - ausführliches wissenschaftliches Standardwerk.
- Michael Brenner, Sabine Ullmann: Die Juden in Schwaben. München 2013 - interessante regionale Studie zu Schwaben, das zum bedeutendsten jüdischen Siedlungsgebiet Deutschlands gehörte.
- Michael Brenner, Daniela Eisenstein: Die Juden in Franken. München 2013 - seit dem 11. Jahrhundert lebten Juden in Franken, weshalb sich dort eine vielfältige jüdische Kulturtradition entwickelte.
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Das Kalenderblatt erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks.
DAS KALENDERBLATT
Weiterführende Links:
Das Judentum im 19. Jahrhundert in Bayern
Sabine Ullmann, Judentum (19. Jahrhundert), publiziert am 23.05.2023; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Judentum_(19._Jahrhundert)>
Jüdisches Leben in Bayern
https://hdbg.eu/juedisches_leben/
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
Sprecher
Bayern um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Eine Umbruchzeit, die stark von der Aufklärung geprägt wurde. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, diese Forderungen der französischen Revolution verhallten auch in Bayern nicht ungehört. Freiheit, seine Religion auszuüben, Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, Brüderlichkeit als gesellschaftliche Teilhabe für Alle. Auch für eine Minderheit, die bisher in Bayern nur in Ausnahmefällen geduldet war: die Juden.
Sprecherin
Die Wittelsbacher hatten jahrhundertelang keine Juden in ihren Landen geduldet. Im 15. Jahrhundert war diese religiöse Minderheit aus Alt-Bayern vertrieben worden. Nur in wenigen Fällen wurden Ausnahmen gemacht. Hoffaktoren beispielsweise, die den Herrschenden nützlich waren, wurden geduldet. Nun rüttelte nicht nur die Aufklärung an dieser Haltung, sondern Bayern gewann darüber hinaus bis 1815 große Territorien in Franken und Schwaben hinzu. Und damit auch jüdische Untertanen. Denn nachdem sie im späten Mittelalter aus den Städten vertrieben worden waren, hatten sich Juden häufig im ländlichen fränkischen und schwäbischen Bereich niedergelassen und hier Gemeinden gegründet. Diese Gebiete fallen nun an das Königreich Bayern. Dort hat zu diesem Zeitpunkt Maximilian von Montgelas großen Einfluss.
Schneidawind O-Ton 1
3:57 Die sogenannten Montgelas'schen Reformen, die eben auch das sogenannte Juden Edikt von Achtzehnhundertdreizehn, die sind sehr stark gekennzeichnet, eben auch von diesem Gedanken, ja, Juden so, sofern sie sich nützlich machen für den Staat, können wir überlegen, ihnen schrittweise Zugeständnisse zu machen und ihnen auch mehr Rechte einzuräumen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass dieses Judenedikt von Achtzehnhundertdreizehn eben stark von diesen Nützlichkeitsgedanken geprägt war und also natürlich, also gerade für das Gebiet Altbayerns, also auch der jüdischen Gemeinde Münchens durchaus Vorteile hatte, einfach weil es sozusagen eine erstmal so eine gewisse Form der Rechtssicherheit mit sich brachte. Also es war erstmals geregelt, gewisse wirtschaftliche Einschränkungen wurden aufgehoben, man durfte sich, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt, auch mit diesem sogenannten Matrikeleintrag niederlassen.
Sprecher
Dr. Julia Schneidawind ist Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der erwähnte Maximilian von Montgelas war der umtriebige und einflussreiche Modernisierer im Ministerium von König Maximilian.
Sprecherin
Das "Edikt über die Verhältnisse der jüdischen Glaubensgenossen im Königreiche Baiern", das Montgelas federführend gestaltete, garantierte freie Religionsausübung und Rechtssicherheit, hob die alten Berufsverbote auf, verpflichtete die jüdischen Kinder zum Schulbesuch und die jungen Männer zum Militärdienst, ermöglichte ihnen höhere Bildungswege. Erste Schritte zur Integration waren damit getan. Doch der Staat wollte weiterhin die Kontrolle behalten, und so wurde mit dem Edikt gleichzeitig die Anzahl der jüdischen Familien in Ortschaften und Städten begrenzt.
Sprecher
In Verzeichnissen, sogenannten Matrikeln, erfasste die örtliche Polizeibehörde die jüdischen Mitbürger, und wenn die streng festgelegte Zahl erreicht war, durfte niemand mehr zuziehen. Dies war in Alt-Bayern weniger ein Problem als in den neu-bayerischen Gebieten, Schwaben und Franken. Julia Schneidawind:
Schneidawind O-Ton 3
7:29 Gerade dieses Gebiet ist sehr stark davon betroffen, weil man eben unter diesen Obergrenzen sich nicht niederlassen konnte, wo man wollte und vor allem auch nicht dort bleiben konnte, wo man vielleicht sehr lange war, sondern man musste sich anders orientieren...
Das bedeutete, dass in Schwaben und in Franken Jüdinnen und Juden wegziehen mussten. Eine Art, dieses Problem zu lösen, war durch Wegheiraten.
Schneidawind O-Ton 4a
37.27 Ich denke innerhalb der Familien gab es schon so ne gewisse Praxis, dass der älteste Sohn dann praktisch den Hof übernimmt, oder was auch immer eben da war …
Sprecherin
Juden, die im Viehhandel oder als Metzger tätig waren, durften regional in kleinem Umfang Land besitzen oder pachten.
Schneidawind O-Ton 4b
… und dann die Jüngeren, die hat man dann vor allem versucht über Heiratspolitik anderweitig unterzubringen und da musste man auf diese Netzwerke auch zurückgreifen und da gab es ja auch so was wie Heiratsvermittlung, was jetzt nichts mit Zwangsehe zu tun hat, sondern da gab es Personen, die sozusagen da irgendwie auf dem Schirm hatten, wer ist gerade im Alter, wer sucht gerade? Und dann gab es da wirklich so Netzwerke, wo man versucht hat, auch über Familienbanden natürlich zu gucken, wo können wir XY am besten unterbringen und das ist natürlich mit sehr viel Unsicherheit und ja, auch Problemen in der Lebenswirklichkeit verbunden war, das ist auf jeden Fall so.
Sprecher
Zusätzlich kam es zu einer großen Auswanderungswelle. Über 11.000 jüdische Menschen aus Franken und Schwaben suchten ein besseres Leben in Übersee. Viele von ihnen wurden sehr erfolgreich. Denn sie hatten ja dank des „Judenediktes“ bereits eine Schul- und Berufsausbildung absolviert und konnten sich in den USA als freie und gleichberechtigte Bürger eine Existenz aufbauen.